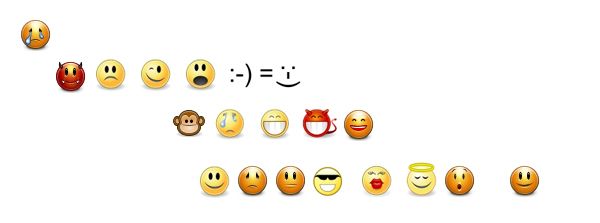Menschen lieben und hassen einander, sie sind wütend, traurig oder fröhlich, sie neiden ihrem Nachbarn das Auto, streben aus Ehrgeiz nach beruflichen Erfolgen oder ermorden einen Nebenbuhler aus Eifersucht. Kurzum: Sie fühlen. Trotz dieser Allgegenwart von Gefühlen in sozialen Praktiken wurde der Mensch als fühlendes Wesen – als „homo emoticus” – von den Sozial-, Kultur- und Geisteswissenschaften des 20. Jahrhunderts lange ausgeblendet. Seit einiger Zeit ist dieses Desinteresse allerdings in sein Gegenteil umgeschlagen, und das Versäumte wird mit großer Verve nachgeholt. Nicht mehr allein Vertreter/innen der Psychologie, sondern auch der Soziologie und Philosophie, der Kulturanthropologie und Erziehungswissenschaften, der Politologie und der Ökonomie versuchen derzeit, Gefühle als Element der conditio humana ernst zu nehmen und zu untersuchen.[1]
In der Geschichtswissenschaft zeichnet sich dieser emotional turn ebenfalls ab.[2] Wurden Gefühle früher eher beiläufig mitbehandelt statt analysiert, sind sie inzwischen zum expliziten Thema von Monografien und Sonderheften, Tagungen und Sammelbänden geworden, welche etwa den „Einfluss von Emotionen auf die Politik des 19. und 20. Jahrhunderts” oder „Angst im Kalten Krieg” behandeln. Wie diese Publikationen verdeutlichen, sind auch die klassischen Themen der Zeitgeschichte eng mit Gefühlen verknüpft. Ohne die Angst vor der Atombombe zu thematisieren, um ein Beispiel herauszugreifen, würden Alltagserfahrungen im Zeitalter des Kalten Krieges nur unzureichend erfasst – und das gilt auch für die Entscheidungen damaliger Regierungschefs, die mit dieser Angst Politik betrieben.[3] Daher beansprucht die historische Emotionsforschung mehr, als ein bislang wenig beachtetes Themenfeld zu erkunden. Die Geschichte der Gefühle soll sich nicht in einer Nische abseits des Mainstream einrichten, sondern neue Einblicke in kultur-, sozial-, politik- und sogar wirtschaftshistorische Themen verschaffen und zugleich die überkommenen Prämissen der Zweckrationalität menschlichen Handelns mit Nachdruck überwinden.[4]
Vor dem Hintergrund dieses hohen Anspruchs und der mit ihm mitunter verknüpften Goldgräberstimmung, die es kritisch zu reflektieren gilt, versucht der vorliegende Artikel erstens, Gefühle als Forschungsgegenstand genauer zu erfassen. Dieser Abschnitt zielt aber nicht auf akkurate Grenzziehungen, sondern im Gegenteil auf deren historische Verflüssigung. Zweitens werden verschiedene Forschungsstrategien vorgestellt, mit deren Hilfe man Emotionen als fluidem Nicht-Gegenstand auf die Spur kommen kann, nämlich ausgehend von Gefühlswörtern, -regeln und -praktiken. Das abschließende Fazit resümiert die Ergebnisse, um auf dieser Grundlage nach konkreten Forschungsperspektiven der Zeitgeschichte zu fragen.
1. Was sind Gefühle – nicht? Semantische Annäherungen und Verflüssigungen
Was sind Gefühle? Die Antwort auf diese Frage fällt sehr unterschiedlich aus, je nachdem, ob sich beispielsweise Psycholog/innen, Philosoph/innen oder Soziolog/innen bzw. sogenannte Experten oder Laien äußern. Das Verständnis von Gefühlen ist aber nicht nur in synchroner Perspektive uneinheitlich, sondern hat sich auch diachron immer wieder verschoben. Zuletzt haben poststrukturalistisch orientierte Vertreter der Kultur- und Theaterwissenschaften davor gewarnt, ein Gefühl überhaupt als Gegenstand zu denken. Denn es handele sich „um ein performatives Phänomen, das nur im Moment seines Vollzugs, in flüchtigen und veränderlichen Konstellationen der Darstellung, Artikulation und Wahrnehmung” existiere.[5] Tatsächlich scheint gerade das Transitorische, Atmosphärische zu den hervorstechenden Merkmalen des Themas zu gehören und seinen Reiz auszumachen. Anstatt daher nach einer klar umrissenen Definition zu suchen, ist es sinnvoller, in der Gefühlsgeschichte weit und offen all das in Augenschein zu nehmen, was von historischen Akteuren mit Worten wie „Gefühl”, „Emotion”, „Affekt” oder „Leidenschaft” bzw. mit semantisch ähnlichen Worten in anderen Sprachen bezeichnet wurde. Die Bedeutungsgehalte all dieser Termini haben sich allerdings ständig verändert; zudem ist die enorme Variabilität von Gefühlswörtern gerade in transkultureller Perspektive offensichtlich.
Dass Gefühlen in sozial- und kulturwissenschaftlichen Abhandlungen des 20. Jahrhunderts lange Zeit wenig Aufmerksamkeit zukam, hängt aber keineswegs mit den daraus resultierenden konzeptionellen Unsicherheiten zusammen. Verantwortlich ist vielmehr die vermeintliche Gewissheit, Gefühle seien erstens irrational und nicht-kognitiv, zweitens universal und ahistorisch sowie drittens im Inneren des Individuums verankert und daher unsichtbar. Vor diesem Hintergrund galten sie diversen Disziplinen als ein natürliches und privates Phänomen, das sich sozialen Einflüssen ebenso entziehe wie der sozialwissenschaftlichen Analyse. „Sowohl Entstehung als auch Funktion von Emotionen”, kritisierte der Soziologe Jürgen Gerhards vor über zwei Dekaden, würden entweder „aus idiosynkratischen Momenten der Persönlichkeit oder aus universellen Qualitäten des Menschen überhaupt” abgeleitet. Entsprechend habe man sie im Prozess der Ausdifferenzierung der Wissenschaften der Psychologie „zugeschlagen”.[6]
Die spezifisch westlich-moderne Konzeptualisierung von Gefühlen als irrational, unsichtbar und universal[7] hat ihre Überzeugungskraft aber in den letzten Dekaden auf breiter Front eingebüßt. Die Verläufe und Ursachen dieses keineswegs einheitlichen oder gar linearen Trends wären selbst ein reizvoller Gegenstand zeitgeschichtlicher Forschung, der an dieser Stelle leider nicht vertieft werden kann. Im Ergebnis jedenfalls bezweifeln verschiedene Disziplinen inzwischen erstens das irrationale Moment von Gefühlen. Wie Neurowissenschaften, Psychologie und Philosophie mit sehr unterschiedlichen Stoßrichtungen und auf je eigener Grundlage ausbuchstabieren, sind Emotionen alles andere als das Gegenstück menschlicher Vernunft und Verstandeskraft. Vielmehr sind emotionale und kognitive Operationen unmittelbar aufeinander angewiesen, und Gefühle verfügen über ihre eigene Rationalität.[8] Wer sich intuitiv für A statt B entscheidet, so lässt sich sehr vereinfacht schlussfolgern, oder wen in einer bestimmten Situation ein „ungutes Gefühl” beschleicht, der kann hierfür gute Gründe haben – nur sind ihm diese nicht notwendig bewusst. Umgekehrt mischen sich Gefühle in unsere Bewertungen, Überlegungen und Handlungen auch dann ein, wenn wir uns gezielt um rationale Reflexion bemühen und von Gefühlen zu abstrahieren suchen.
Zweitens zeichnet sich zumindest in den Kulturwissenschaften die Tendenz ab, nicht länger zwischen dem vermeintlichen Kern eines Gefühls im Inneren des Individuums sowie seiner mehr oder weniger verzerrten „äußeren” Repräsentation zu unterscheiden. Stattdessen wird dafür plädiert, Gefühle als genuin soziale Phänomene zu denken, die in zwischenmenschlicher Interaktion mit Hilfe von Gesten, Mimiken oder Worten nicht bloß nachträglich ausgedrückt, sondern vielmehr modelliert oder sogar hergestellt werden. An die Stelle eines ontologisch-hydraulischen Gefühlsmodells, wonach eine aus dem Körperinneren kommende Kraft wie eine Flüssigkeit nach außen drängt, die es qua Verstandesleistung und Willenskraft oder sozialer Normierung zu kontrollieren gilt, tritt damit eine Vorstellung des Fühlens als soziale Praxis und kulturelle Konstruktion. „Once de-essentialized”, so formuliert die Kulturanthropologin Catherine Lutz, „emotion can be viewed as a cultural and interpersonal process of naming, justifying, and persuading by people in relationship to each other.” Emotionale Erfahrung sei deshalb als „not precultural but preeminently cultural” anzusehen.[9]
Drittens verweisen immer mehr Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auf die kulturelle Variabilität von Gefühlen. Denn nicht nur das Alltagsverständnis und die wissenschaftlichen Konzeptionen, die normativen Bewertungen und öffentlichen Zuschreibungen von Emotionen unterscheiden sich zwischen den Kulturen, sondern auch die Praxis des Gefühlsausdrucks und die Erfahrung des Fühlens selbst. Das betonen Kulturanthropolog/innen wie unter anderem die eben zitierte Catherine Lutz, aber ebenso sozialkonstruktivistisch orientierte Psychologen. Ihnen zufolge ist der Mensch nicht mit einer emotionalen hardware ausgestattet, die sich evolutionär herausgebildet hat, sondern Gefühle sind – zumindest zu erheblichen Teilen – kulturell gelernte Einstellungen.[10]
Die Geschichtswissenschaften schließlich verweisen auf die Varianz von Gefühlen nicht nur im Raum, sondern auch in der Zeit. Gefühle, so prägnant Ute Frevert, würden einerseits Geschichte machen, indem sie etwa handlungsmotivierend wirkten, aber andererseits auch selbst über eine Geschichte verfügen – und diese gelte es zu ergründen.[11] Damit knüpft Frevert an das prominente Plädoyer des französischen Historikers Lucien Febvre an, der frühzeitig dazu aufrief, Emotionen als „ansteckend” zu begreifen und als Thema zu erkennen.[12] Dass Gefühle nicht nur sozial und kulturell modelliert sind, sondern auch politisch instrumentalisiert und choreographiert werden können, dafür ist der zu Febvres Zeiten herrschende Nationalsozialismus ein besonders verhängnisvolles Beispiel. Solche Einsichten liefern allerdings noch keinen Hinweis darauf, ob und wie sich Gefühle historisch untersuchen lassen. Welche methodisch-theoretischen Perspektiven wurden in der Geschichtswissenschaft zuletzt entwickelt?
2. Wie können Gefühle untersucht werden? Von Gefühlsworten, -regeln und -praktiken
Ein erster Ausgangspunkt, um Gefühle trotz und mit ihrer Fluidität in Augenschein zu nehmen, sind die Gefühlswortschätze[13], die im Rahmen einer Wissens- oder Wissenschaftsgeschichte zu untersuchen wären. Das in öffentlichen und akademischen Diskursen produzierte Wissen über das Fühlen, welches an Termini wie „Angst” oder „Hass” haftet, ist dabei immer auch als Instrument von Regulierungs- und Kontrollversuchen sowie politischen Machtkämpfen zu lesen. Symptomatisch für die europäische und nordamerikanische Geschichte des 20. Jahrhunderts ist beispielsweise die im Alltagswissen wie in Expertendiskursen nur langsam schwindende Vorstellung, Frauen seien von Natur aus „expressiver” als Männer – diese maßgeblich auf die Aufklärung zurück gehende Naturalisierung, die oft eine klare Abwertung des weiblichen Geschlechts impliziert, wird in manchen Wissenschaften bis heute fortgeschrieben.[14]
Neben der historischen Semantik wäre in diesem Rahmen auch die Pragmatik von Gefühlsworten zu beleuchten – gleichsam ihr Einsatz in der sozialen Praxis. Denn Worte wie „Wut” oder „Trauer” sind keineswegs nur nachträglich entwickelte, äußerlich bleibende Etikettierungen eines im Voraus bereits bestehenden, stabilen Phänomens. Stattdessen beeinflussen sie das Fühlen selbst. Diese Einsicht hat vor allem der amerikanische Historiker William Reddy für die Geschichtswissenschaft fruchtbar gemacht. Ebenso auf die Sprechakttheorie John Austins wie auf die kulturanthropologische und kognitionspsychologische Gefühlsforschung rekurrierend, warnt Reddy zunächst vor dem konstruktivistischen Fehlschluss, Gefühle auf ihre sprachliche Dimension zu reduzieren oder als ausschließlich kulturell zu begreifen. Stattdessen betont er Wechselwirkungen zwischen „inneren” emotionalen Befindlichkeiten und den sprachlichen Äußerungen über diese. Letztere bezeichnet Reddy als emotives. Mit ihrer Hilfe scheinen Akteure ihr Gefühlsleben weder deskriptiv abzubilden noch performativ herzustellen, sondern eher – wie bei einem Schiff auf hoher See – mit unsicherem Ausgang zu „navigieren”. Man könne sich leicht vorstellen, liefert Reddy ein Beispiel, „a person stating ‚I'm very angry with you' and then finding that, just by saying this, he or she had caused the anger to dissipate”.[15] Eine unübersehbare Stärke dieses hier nur sehr vereinfacht und in Ausschnitten skizzierten Ansatzes liegt darin, dass Reddy Fühlen und Kommunizieren in ein dynamisches statt hierarchisches Verhältnis setzt. Einer von mehreren Nachteilen allerdings ist, dass die nicht-sprachliche Eigenwilligkeit von Gefühlen zu großen Teilen als kognitionspsychologische Prämisse in die Analyse eingeflochten wird. Empirisch untersucht werden kann diese nicht; letztlich gelten die Möglichkeiten und Grenzen des Gehirns apriorisch.
Ein zweiter, eher konventioneller Ausgangspunkt einer Geschichte der Gefühle sind historisch wandelbare Regeln des Fühlens, die das Spektrum der in einer bestimmten sozialen Gruppe als legitim erachteten Gefühle, deren Intensität und Dauer sowie die Formen des Gefühlsausdrucks (zum Beispiel lautes Schluchzen oder stummes Weinen) vorschreiben können. Innerhalb der Geschichtswissenschaft hat sich vor allem Peter Stearns der Analyse zeitgenössisch proklamierter Gefühlsnormen angenommen. Der von ihm und Carol Stearns entwickelte Ansatz der emotionology plädiert für die Unterscheidung von sogenannten „collective emotional standards of a society” einerseits, also den Gefühlsnormen in einer sozialen Gruppe, und der „emotional experience of individuals and groups” andererseits. Beide Ebenen stünden in Spannung zueinander, wobei das Hauptaugenmerk der Stearns den „emotional standards” gilt, die sie etwa über Ratgeberliteratur untersuchen, sowie den „social factors that determine and delimit, either implicitly or explicitly, the manner in which emotions are expressed”.[16]
Zu den Problemen dieses Ansatzes gehört, dass die scharfe Trennung zwischen sozialen Anforderungen und subjektiven Erfahrungen auf der fragwürdigen Annahme beruht, es gebe eine ursprüngliche emotionale Disposition, die durch soziale Normen nachträglich überlagert und eingehegt würde. Gleichwohl bietet das Programm der emotionology noch immer einen sinnvollen Ausgangspunkt, wenn in erster Linie normative Texte als Quelle genutzt werden sollen – und zwar am besten in Bezug auf Akteure, die selbst zwischen sozial erwarteten und vermeintlich authentischen Gefühlen unterscheiden.
Allerdings wird das Wissen über die in bestimmten sozialen Gruppen und Institutionen bestehenden Regeln des Fühlens nicht notwendig in normativen Schriften explizit reflektiert und vermittelt, sondern es bildet sich vor allem schleichend in der sozialen Praxis heraus. Genau darauf verweist die amerikanische Soziologin Arlie Hochschild, deren Ansatz von vornherein Praktiken des Fühlens ins Zentrum der Analyse rückt. In Weiterentwicklung Erving Goffmans geht sie davon aus, dass vermeintlich hochgradig individuelle emotionale Erfahrungen im Alltagsleben Regelmäßigkeiten ausbilden. Denn Menschen versuchen nicht nur, sich in einer Situation „angemessen” zu verhalten, sondern auch: angemessen zu fühlen. Man kann sich beispielsweise leicht vorstellen, dass die meisten Menschen bei der Beerdigung des 1963 ermordeten US-amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy durchaus nicht damit zufrieden gewesen wären, die von ihnen erwartete Traurigkeit anderen gegenüber oberflächlich vorzutäuschen. Eher versuchten sie, „tatsächlich” traurig zu sein, also in der Gefühlsperformance Authentizität herzustellen. Auch in anderen Situationen beobachteten und arrangierten, bremsten und verstärkten Menschen ihre eigenen Gefühle, um sie mit sozialen Erwartungen in Einklang zu bringen, sei es als liebevolle Mutter oder freundliche Verkäuferin. So wurde in der Familie ebenso wie in der vermeintlich gefühlsfreien Sphäre der Ökonomie gezielte Gefühlsarbeit vollzogen. Solche „emotion work”, die ebenso verbal wie nonverbal betrieben werden kann, definiert Hochschild als „the act of trying to change in degree or quality an emotion or feeling”, wobei die bloße Anstrengung nichts über den Erfolg besage.[17]
Hochschilds schon in den 1980er-Jahren entwickelter Ansatz ist trotz mancher Schwächen für eine Geschichte des Fühlens aus zwei Gründen noch immer anregend. Erstens verlangt er keine – ontologisch heikle – Festlegung auf bestimmte Gefühle vor Beginn der Analyse. Und zweitens entgeht er vorschnellen Verallgemeinerungen über die Reichweite von Gefühlsnormen. Denn die Soziologin richtet ihren Blick stets auf spezifische Praxisfelder, die feeling rules ausbilden und den Akteuren eine spezifische Gefühlsarbeit abverlangen. So zeigt Hochschild in ihrer Studie „Das gekaufte Herz” unter anderem, wie von Frauen in modernen Dienstleistungsberufen eine bestimmte emotionale Gestimmtheit erwartet wird. Schon als Teil der Ausbildung lernten die von ihr untersuchten Stewardessen der Fluggesellschaft Delta Airlines, sich den Fluggästen gegenüber beständig freundlich zu verhalten, wobei ihr Lächeln keine Fassade bleiben, sondern „von Herzen” kommen sollte, was zu psychischen Konflikten und Verwerfungen führte. Diesen Folgen der Kommerzialisierung der Gefühle galt Hochschilds Kritik.[18]
Offen ist, inwiefern sich Hochschilds Fokus auf eine regelrechte Arbeit am Gefühl in bestimmten Institutionen mit dem Plädoyer der Mediävistin Barbara Rosenwein verbinden lässt, emotional communities zum Ausgangspunkt der Analyse zu machen. Rosenwein geht davon aus, dass „social communities”, egal ob es sich um „families, neighbourhoods, parliaments, guilts, monasteries” oder „parish church memberships” handele, auch bestimmte „systems of feeling” ausbilden würden.[19] Für die Zeitgeschichte stellt sich die Frage, ob und inwiefern sich das für das frühe Mittelalter entwickelte Konzept konkurrierender und koexistierender emotional communities auf die Analyse moderner Gesellschaften übertragen lässt. Einerseits könnte man sie als Verlängerung sozialer Strukturen lesen – in diesem Falle heften sich Gefühle oder Gefühlsstile gleichsam an soziale Stände, Klassen oder Schichten.[20] Oder es geht um Gruppen, die durch Kommunikation und Interaktion gemeinsame Denk- und Fühlweisen ausbilden. In welchem Grad verschmelzen etwa die Nutzer/innen von Facebook, um ein aktuelles Beispiel anzuführen, zu einer globalen „emotionalen Gemeinschaft”? Diese Frage, die wohl eher zu verneinen wäre, verweist auf die Risiken des Konzepts: Abgesehen von seiner derzeitigen Vagheit wohnt ihm eine harmonisierende Tendenz inne, die Gruppen unterschiedlichster Art als emotional verbunden sieht, ohne anzugeben, wie sich diese Verbundenheit empirisch prüfen lässt.
Wie das Beispiel ebenfalls verdeutlicht, sind Medien auf besondere Weise mit der Geschichte der Gefühle verwoben. Audiovisuelle Quellen bilden Gefühle dabei nicht bloß ab. Vielmehr beeinflussen und verändern sie selbst Deutungen und Praktiken des Fühlens. Wenn eine Hochzeitsgesellschaft auf einem Foto geschlossen in die Kamera lächelt, heißt dies noch keineswegs, dass alle Beteiligten zum Zeitpunkt der Aufnahme guter Laune waren. Stattdessen aber liegt ein Hinweis darauf vor, dass von den Anwesenden Heiterkeit erwartet wurde, dass man dachte, diese am besten durch ein Lächeln ausdrücken zu können, und die Betroffenen bereit waren, für den Fotografen und das Fotoalbum dieses Lächeln auf ihre Lippen zu zaubern. Das Foto der lächelnden Hochzeitsgesellschaft verweist also auf die soziale Normierung, Aufführung und Herstellung von Gefühlen im Zeitalter der Massenmedien.[21] Solche Dynamiken genauer zu erkunden wäre eine erste Aufgabe einer spezifisch zeithistorischen Gefühlsforschung.
3. Fazit: Zeithistorische Desiderate und Perspektiven
Zu den aktuellen Trends der Geschichtswissenschaft, das ist an dieser Stelle zu resümieren, gehört nicht nur die „Sehnsucht nach Gefühlen” (Przyrembel), sondern auch die Sehnsucht nach begrifflichen Konzepten, um ihrer habhaft zu werden. Angesichts des breit gezogenen Panoramas biologistischer, funktionalistischer, hermeneutischer und konstruktivistischer Ansätze in der Disziplinen übergreifenden Gefühlsforschung insgesamt zeichnen sich die in den letzten Jahren unter Historikern und Historikerinnen diskutierten Ansätze durch eine gewisse Ähnlichkeit aus. Den in methodischer Hinsicht besonders einflussreichen und daher im vorherigen Abschnitt knapp skizzierten Interventionen von Peter Stearns, William Reddy und Barbara Rosenwein[22] sowie von Arlie Hochschild ist gemeinsam, dass sie die soziokulturelle Dimension des Fühlens ins Zentrum stellen. Zugleich schimmert an verschiedenen Stellen die Ansicht durch, es gebe doch so etwas wie vorsoziales, natürliches Empfinden, das erst in einem zweiten Schritt von außen beschnitten würde – in sozialkonstruktivistischer Perspektive eine Chimäre, die zudem spezifisch westlich ist.[23] Das verweist nicht nur auf die Dringlichkeit transnationaler Studien, sondern vor allem auf die Gretchenfrage der Emotionsgeschichte, wie sie es mit der vermeintlichen „Biologie” der Gefühle sowie neuro- und kognitionswissenschaftlichen Erkenntnissen hält: Werden diese ihrerseits historisiert oder als Forschungsprämisse einbezogen und „angewendet”?
In methodischer Hinsicht teilen die im vorherigen Abschnitt skizzierten Ansätze zudem das Defizit, dass sie den Körper gar nicht oder nur als stabile Größe in ihre Überlegungen einbeziehen. Schon das in der Umgangssprache geronnene Alltagswissen („strahlende Augen”, „hängende Schultern”) weiß um die körperliche Dimension des Fühlens. Körper sind dabei nicht nur Medium des Ausdrucks, sondern auch Agens der Herstellung von Gefühlen. Hochschild beispielsweise betont, Gefühlsarbeit könne mündlich, aber auch mimisch und gestisch vollzogen werden, etwa durch ein Lächeln.[24] Allerdings hat die noch junge Teildisziplin der Körpergeschichte auf die Historizität körperlicher Erscheinungsformen und Wahrnehmungen verwiesen. Deshalb ist keinesfalls davon auszugehen, dass der menschliche Körper eine universale und unveränderbare Ressource von Gefühlen darstelle. Ebenso wenig gibt er seismografisch über Emotionen Auskunft, etwa qua Pulsschlag oder Schweißabsonderung. Vielmehr ist „der” Körper, der erst seit der Aufklärung als eine von der „Außenwelt” getrennte Einheit gefasst wird, als fragile und wandelbare Materialität vorzustellen, mit deren Hilfe sich Menschen ihrer Gefühle zu vergewissern, sie zu „verkörpern” suchten.[25] Das Navigieren der Gefühle wurde und wird in all seiner Unsicherheit, um an William Reddy anzuknüpfen, also nicht nur mit Hilfe von Worten, sondern auch von Körpern betrieben, was von der Umarmung eines Freundes bis hin zu elaborierten Körpertechniken wie Yoga, Rap oder dem Liegen auf der Couch eines Psychoanalytikers reichen kann.
Es ist kein Zufall, dass von den genannten methodisch-theoretischen Stichwortgebern der aktuellen Debatte nur einer – Peter Stearns – zeithistorisch arbeitet. Hochschild ist Soziologin, Rosenwein Mediävistin und Reddy hat Gefühle vor allem im Rahmen der Französischen Revolution untersucht. Tatsächlich sind zeithistorische Monografien, die Gefühle von vornherein ins Zentrum stellen, noch verhältnismäßig selten, und das gilt erst recht für übergreifende Narrative zu zeithistorischen Tendenzen emotionalen Wandels. Hierzu zählt etwa die These einer Aufwertung von Sensibilität und Expressivität in westlichen Industrieländern seit etwa den 1970er-Jahren[26] oder Stearns Befund, ab den 1920er-Jahren habe sich in den amerikanischen Mittelschichten der „emotional style” der „coolness” durchgesetzt.[27] Gleichwohl sind Gefühle auch in der Zeitgeschichte im Kommen, wie die Phalanx laufender Projekte unschwer erkennen lässt.[28] Die Produktivität der historischen Emotionsforschung, die ihren Gegenstand beständig zu verfehlen droht, wenn sie ihn dingfest machen möchte, ist aber deshalb noch keineswegs ausgemacht. Sie muss sich in den nächsten Jahren erst erweisen.
Anmerkungen
- ↑ Einen empfehlenswerten Forschungsüberblick in transdisziplinärer Perspektive, die Geschichtswissenschaft allerdings ausklammernd, bietet Florian Weber, Von den klassischen Affektenlehren zur Neurowissenschaft und zurück. Wege der Emotionsforschung in den Geistes- und Sozialwissenschaften, in: Neue Politische Literatur 53 (2008), S. 21-42. Für wertvolle Hinweise bedanke ich mich bei Benno Gammerl, Uffa Jensen, Jan Plamper, Maria Rost und Monique Scheer.
- ↑ Zu diesem Terminus siehe Thomas Anz, Emotional Turn? Beobachtungen zur Gefühlsforschung, in: literaturkritik.de 8.2006, http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=10267 (12.05.2010).
- ↑ Vgl. Bernd Greiner/Christian Th. Müller/Dierk Walter (Hrsg.), Angst im Kalten Krieg, Hamburg 2009; Birgit Aschmann (Hrsg.), Gefühl und Kalkül. Der Einfluss von Emotionen auf die Politik des 19. und 20. Jahrhunderts, Stuttgart 2005.
- ↑ Vgl. einführend in die geschichtswissenschaftliche Forschung Barbara Rosenwein, Worrying about Emotions in History, in: The American Historical Review 107 (2002), S. 821-845; Alexandra Przyrembel, Sehnsucht nach Gefühlen. Zur Konjunktur der Emotionen in der Geschichtswissenschaft, in: L’Homme 16 (2005), S. 116-124; Martina Kessel, Gefühle und Geschichtswissenschaft, in: Rainer Schützeichel (Hrsg.), Emotionen und Sozialtheorie, Frankfurt a. M. 2006, S. 29-47; Daniela Saxer, Mit Gefühl handeln. Ansätze der Emotionsgeschichte, in: Traverse 2 (2007), S. 15-29; Ute Frevert, Was haben Gefühle in der Geschichte zu suchen?, in: Geschichte und Gesellschaft 35 (2009), S. 183-208.
- ↑ Vgl. Doris Kolesch, Theater der Emotionen. Ästhetik und Politik zur Zeit Ludwigs XIV, Frankfurt a. M. 2006, S. 23-42, hier S. 31.
- ↑ Jürgen Gerhards, Soziologie der Emotionen. Fragestellungen, Systematik und Perspektiven, München 1988, S. 12.
- ↑ Vgl. hierzu die frühe und pointierte Kritik von Catherine A. Lutz, Unnatural Emotions. Everyday Sentiments on a Micronesian Atoll & their Challenge to Western Theory, Chicago 1988.
- ↑ Im öffentlichen Diskurs besonders einflussreich waren die stark populärwissenschaftliche Darstellung des Neurowissenschaftlers Antonio R. Damasio, Descartes’ Irrtum. Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn, Berlin 2004 (engl. Original 1994), sowie die philosophische Abhandlung von Ronald de Sousa, Die Rationalität des Gefühls, Frankfurt a. M. 1997 (engl. Original 1987). Weitere Literatur bei Weber, Von den klassischen Affektenlehren, S. 30-33.
- ↑ Lutz, Unnatural Emotions, S. 5. Zur geschichtswissenschaftlichen Kritik der auf einem hydraulischen Gefühlsverständnis basierenden Thesen Norbert Elias’, der eine zunehmende Affektkontrolle auf dem Weg in die westliche Moderne behauptet, siehe Rosenwein, Worrying about Emotions.
- ↑ Vgl. Fay C. M. Geisler/Hannelore Weber, Sozial-konstruktivistischer Ansatz der Emotionspsychologie, in: Veronika Brandstätter/Jürgen H. Otto (Hrsg.), Handbuch der Allgemeinen Psychologie, Bd. 1: Motivation und Emotion, Göttingen 2009, S. 456-462, sowie die frühe Intervention von Rom Harré, An Outline of the Social Constructionist Viewpoint, in: ders. (Hrsg.), The Social Construction of Emotion, Oxford 1986, S. 2-14.
- ↑ Frevert, Was haben Gefühle in der Geschichte zu suchen, S. 202.
- ↑ Lucien Febvre, Sensibilität und Geschichte. Zugänge zum Gefühlsleben früherer Epochen (1941), in: Marc Bloch u.a., Schrift und Materie der Geschichte. Vorschläge zur systematischen Aneignung historischer Prozesse, hrsg. von Claudia Honegger, Frankfurt a. M. 1977, S. 313-333, hier S. 316.
- ↑ Ludwig Jäger (Hg.), Zur Historischen Semantik des deutschen Gefühlswortschatzes. Aspekte, Probleme und Beispiele einer lexikographischen Erfassung, Aachen 1988.
- ↑ Vgl. die Kritik von Barbara Rosenwein, Gender als Analysekategorie in der Emotionsforschung, in: Feministische Studien 26 (2008), S. 92-106. Einführend zur Wissenschaftsgeschichte von Gefühlen siehe den Sammelband von Daniel Morat/Uffa Jensen (Hrsg.), Rationalisierungen des Gefühls. Zum Verhältnis von Wissenschaft und Emotionen 1880-1930, München 2008, hier neben der Einleitung vor allem den Beitrag von Jakob Tanner.
- ↑ Vgl. William Reddy, The Navigation of Feeling. A Framework for the History of Emotions, Cambridge 2001, S. 34-111, hier S. 108-137.
- ↑ Vgl. Peter N. Stearns/Carol Z. Stearns, Emotionology: Clarifying the History of Emotions and Emotional Standards, in: American Historical Review 90 (1985), S. 813-836, hier S. 813.
- ↑ Arlie R. Hochschild, Emotion Work, Feeling Rules, and Social Structure, in: The American Journal of Sociology 85 (1979), S. 551-575, hier S. 561.
- ↑ Siehe Arlie R. Hochschild, Das gekaufte Herz. Zur Kommerzialisierung der Gefühle, Frankfurt a. M. 1990 (engl. Original 1983).
- ↑ Rosenwein, Worrying about Emotions, S. 842.
- ↑ Vgl. hierzu Hans-Ulrich Wehler, Emotionen in der Geschichte: Sind soziale Klassen auch emotionale Klassen?, in: Christof Dipper/Lutz Klinkhammer/Alexander Nützenadel (Hrsg.), Europäische Sozialgeschichte. Festschrift für Wolfgang Schieder, Berlin 2000, S. 461-473.
- ↑ Einführend zur Dynamik von Medien und Emotionen vgl. Frank Bösch/Manuel Borutta (Hrsg.), Die Massen bewegen. Medien und Emotionen in der Moderne, Frankfurt a. M.2006.
- ↑ Zur Rezeption dieser Autor/innen vgl. vor allem Saxer, Mit Gefühl handeln; Przyrembel, Sehnsucht nach Gefühlen, sowie jetzt Jan Plamper, The History of Emotions: An Interview with William Reddy, Barbara Rosenwein, and Peter Stearns, in: History and Theory 49 (2010), S. 237-265.
- ↑ Vgl. Lutz, Unnatural Emotions.
- ↑ Vgl. Hochschild, Emotion Work, S. 562.
- ↑ Zur Verkörperung von Emotionen vgl. die Literaturhinweise bei Weber, Von der klassischen Affektenlehre, S. 35f., sowie Eva Labouvie, Leiblichkeit und Emotionalität, in: Handbuch der Kulturwissenschaften, hrsg. v. Friedrich Jaeger/Burkhard Liebsch/Jörn Rüsen, Bd. 3: Themen und Tendenzen, Stuttgart 2004, S. 79-91, und jetzt Pascal Eitler/Monique Scheer, Emotionengeschichte als Körpergeschichte. Eine heuristische Perspektive auf religiöse Konversionen im 19. und 20. Jahrhundert, in: Geschichte und Gesellschaft 35 (2009), S. 282-313.
- ↑ Vgl. die frühen Anmerkungen von Gerhards, Soziologie der Emotionen, S. 17, sowie jetzt Frank Biess, Die Sensibilisierung des Subjekts: Angst und „neue Subjektivität“ in den 1970er Jahren, in: Werkstatt Geschichte 49 (2008), S. 51-72.
- ↑ Peter N. Stearns, American Cool. Constructing a Twentieth-Century Emotional Style, New York 1994. Einschlägig in der zeithistorischen Emotionsforschung sind u.a. auch die Studie von Joanna Bourke, Fear. A Cultural History, London 2005, sowie die Veröffentlichungen der Wissenschaftshistorikerin Ruth Leys, John Hopkins University.
- ↑ Vgl. u.a. das laufende Projekt von Frank Biess, University of California, über „deutsche Angst“ sowie eine Reihe von Projekten und Projektvorstellungen am Forschungsbereich „Geschichte der Gefühle“ des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, Berlin.
Anne Fleig, Ingrid Kasten, Claudia Benthien (Hrsg.), Emotionalität. Zur Geschichte der Gefühle, Böhlau, Köln 2000, ISBN 3-412-08899-4.
Frank Biess, Die Sensibilisierung des Subjekts: Angst und „Neue Subjektivität“ in den 1970er Jahren, in: Werkstatt Geschichte. 49, 2008, ISSN 0933-5706, S. 51-72 (online).
Manuel Borutta, Frank Bösch (Hrsg.), Die Massen bewegen: Medien und Emotionen in der Moderne, Campus, Frankfurt a. M. 2006, ISBN 978-3-593-38200-5.
Joanna Bourke, Fear. A Cultural History, Virago, London 2005, ISBN 1-8440-8157-5.
Ute Frevert, Was haben Gefühle in der Geschichte zu suchen?, in: Geschichte und Gesellschaft. 35, 2009, ISSN 0340-613X, S. 183-208.
Jürgen Gerhards, Soziologie der Emotionen. Fragestellungen, Systematik und Perspektiven, Juventa, München 1998, ISBN 3-7799-0586-8.
Dierk Walter, Christian Th. Müller, Bernd Greiner (Hrsg.), Angst im Kalten Krieg, Hamburger Editionen, Hamburg 2009, ISBN 978-3-86854-213-4.
Arlie R. Hochschild, Das gekaufte Herz. Zur Kommerzialisierung der Gefühle, Campus, Frankfurt a. M. 1990, ISBN 3-593-38012-9.
Martina Kessel, Gefühle und Geschichtswissenschaft, in: Rainer Schützeichel (Hrsg.), Emotionen und Sozialtheorie. Disziplinäre Ansätze. Campus, Frankfurt a. M. 2006, ISBN 3-593-37754-3, S. 29-47.
Uffa Jensen, Daniel Morat (Hrsg.), Rationalisierungen des Gefühls. Zum Verhältnis von Wissenschaft und Emotionen 1880-1930, Fink, München 2008, ISBN 9783770546794.
William M. Reddy, The Navigation of Feeling. A Framework for the History of Emotions, Cambridge University Press, Cambridge 2001, ISBN 978-0521803038.
Barbara Rosenwein, Worrying about Emotions in History, in: American Historical Review 107. 2002, ISSN 0002-8762, S. 821-45 (online).
Barbara Rosenwein, Gender als Analysekategorie in der Emotionsforschung, in: Feministische Studien 26. 2008, ISSN 0723-5186, S. 92-106.
Daniela Saxer, Mit Gefühl handeln. Ansätze der Emotionsgeschichte, in: Traverse. Zeitschrift für Geschichte / Revue d'histoire. 14, Nr. 2, 2007, ISSN 1420-4355, S. 15-29.
Peter N. Stearns, American Cool. Constructing a Twentieth-Century Emotional Style, New York University Press, New York 1994, ISBN 9780814779965.
Florian Weber, Von den klassischen Affektenlehren zur Neurowissenschaft und zurück. Wege der Emotionsforschung in den Geistes- und Sozialwissenschaften, in: Neue Politische Literatur. Nr. 53, 2008, ISSN 0028-3320, S. 21-42.
Copyright © 2010 - Lizenz:
![]() Dieser Text wird veröffentlicht unter der Lizenz „Creative Commons by-sa
3.0 (unportiert)“. Die Nutzung des Textes, vollständig, in Auszügen oder in
abgeänderter Form, ist auch für kommerzielle Zwecke bei Angabe des Autors bzw. der Autorin
und der Quelle zulässig. Im Artikel enthaltene Abbildungen und andere Materialien werden von
dieser Lizenz nicht erfasst. Detaillierte Angaben zu dieser Lizenz finden Sie unter: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de.
Dieser Text wird veröffentlicht unter der Lizenz „Creative Commons by-sa
3.0 (unportiert)“. Die Nutzung des Textes, vollständig, in Auszügen oder in
abgeänderter Form, ist auch für kommerzielle Zwecke bei Angabe des Autors bzw. der Autorin
und der Quelle zulässig. Im Artikel enthaltene Abbildungen und andere Materialien werden von
dieser Lizenz nicht erfasst. Detaillierte Angaben zu dieser Lizenz finden Sie unter: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de.