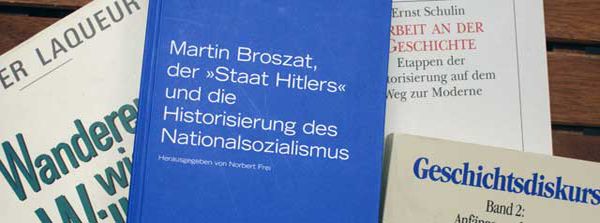Publikationsserver des Leibniz-Zentrums für
Zeithistorische Forschung Potsdam
e.V.
Archiv-Version

Historisierung
Version: 2.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 22.10.2012 https://docupedia.de/kolar_historisierung_v2_de_2012
DOI: https://dx.doi.org/10.14765/zzf.dok.2.264.v2
Verfremdung und Vergegenwärtigung: Bedeutungsdimensionen und Traditionen der Historisierung
Der Begriff „Historisierung” stellt sicherlich keine Neuheit in der Diskussion über Geschichtstheorie dar. In der Zeitgeschichte hat er sich insbesondere dank der Auseinandersetzung zwischen Martin Broszat und Saul Friedländer über das zulässige Ausmaß historischer Relativierung des Nationalsozialismus etabliert, und in der Tat würden die meisten Fachkolleginnen und -kollegen den Begriff wahrscheinlich mit diesem intellektuellen Ereignis assoziieren.[1] Dennoch nahm der Begriff bisher keineswegs einen zentralen Platz in den fachhistorischen Debatten ein.[2]
Im Grunde lassen sich zwei Bedeutungsdimensionen von „Historisierung” ausmachen. Im breiteren Sinne kann man Historisierung zunächst als einen Akt der Transformation von „toten”, vergangenen Überlieferungen und Artefakten in sinnvolle, zeitlich geordnete Erzählungen und Geschichten begreifen, die in Anfang, Geschehen und Ende aufgeteilt sind. Res gestae werden zu historia rerum gestarum. Diese Umformungsleistung ist ein wesentliches Charakteristikum der Geschichtsschreibung seit ihrer Entstehung im Altertum, als sie der Altertumskunde als „systematische [r] Beschreibung der Zustände” eine Geschichte als „chronologische Darstellung der Ereignisse” entgegenstellte.[3] In der Neuzeit entwickelten Theoretiker der Geschichtsschreibung unterschiedliche Begrifflichkeiten für die Beschreibung dieser Operation, unter welchen Johann Gustav Droysens Umwandlung der Geschäfte in Geschichte wahrscheinlich die bekannteste ist, während Theodor Lessings Sinngebung des Sinnlosen und Hayden Whites Emplotment die radikalsten sind.[4] Die Vergangenheit wird zu einer Geschichte geformt, indem sie in eine kohärente, sinnvolle Erzählung umgewandelt wird, sei es in Form einer wissenschaftlichen Dissertation, eines Romans, eines Films, eines Denkmals oder Gemäldes.
Zum Zweiten setzt allerdings die Transformation der Vergangenheit in Geschichte voraus, dass vergangene Ereignisse und Überlieferungen zum Gegenstand des „historischen Interesses” werden. Der Vergangenheit werden Bedeutungen zugeschrieben, die für den Beobachter bzw. Geschichtsschreiber in der Gegenwart relevant sind. Dies war bereits Geschichtsdenkern wie Leopold von Ranke oder Droysen –„Nur was erinnert wird, ist unvergangen, d.h. wenn auch gewesen, doch noch gegenwärtig, und nur was so ideell gegenwärtig ist, ist für uns gewesen”[5] – sowie Max Weber klar, der über „Wertbeziehung” sprach.[6] Eng verbunden mit diesem Gedanken war jedoch die skeptische Vorstellung, dass Geschichte durch die Gegenwart nicht nur gestaltet wird, sondern ihr sogar untergeordnet sein kann. Die Gefahr, dass Geschichte zur Dienstmagd der Gegenwart werden könnte, wurde bereits von Goethe erkannt und spöttisch kommentiert („Mein Freund, die Zeiten der Vergangenheit sind uns ein Buch mit sieben Siegeln. Was ihr den Geist der Zeiten heißt, das ist im Grund der Herren eigner Geist, in dem die Zeiten sich bespiegeln.”[7]). Später wurde dieses Verhältnis wieder aufgenommen und ins Positive gewendet, zum Beispiel von Benedetto Croce, für den „echte” Geschichte immer Zeitgeschichte, d.h. politisch verwertbare Geschichte war.[8] Diese komplizierte, aber unhintergehbare Verbindung zwischen Geschichte und Gegenwart beschäftigte alle modernen Geschichtsdenker: Wie soll man der Szylla des Präsentismus ausweichen, ohne in die Charybdis des trockenen Antiquarentums zu geraten? Lange Zeit sahen Historiker und Philosophen die Voraussetzung einer unbefangenen, objektiven Geschichtsbetrachtung, d.h. einer Geschichtserzählung, die gegenwärtige Leidenschaften eliminieren würde, in einem adäquaten zeitlichen Abstand des Geschichtsschreibers zu seinem Untersuchungsgegenstand: ein Gedanke, den am besten Hegel erfasste, als er die Philosophie (und übertragen auch die Geschichte) mit der Eule der Minerva verglich, die ihren Flug erst mit der einbrechenden Dämmerung beginnt, was bedeuten sollte: die den Prozess des Verstehens und Erklärens erst beginnen kann, wenn das zu erklärende Ereignis vorbei ist.[9] Dieser Gedanke galt bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg als ausschlaggebendes Argument gegen die Etablierung der Zeitgeschichte als vollgültiger wissenschaftlicher Disziplin.
Trotzdem lassen sich berühmte Beispiele aus der Geschichte der Geschichtsschreibung nennen, die eben diese angenommene Bedeutung der zeitlichen Entfernung des forschenden Subjekts als Garant seiner Objektivität relativieren. So würde niemand bezweifeln, dass Theodor Mommsens „Römische Geschichte”[10] ein hervorragendes Werk der europäischen Geschichtsschreibung von dauerndem Wert ist. Gleichzeitig würde jedoch kaum jemand zögern, diese Geschichtserzählung als „ahistorisch” zu bezeichnen, weil sie ganz offenkundig die „Geschäfte” des politischen Kampfes im Deutschland der Mitte des 19. Jahrhunderts in ihre Darstellung altertümlicher Ereignisse hineinträgt. Die italienische Geschichtsschreibung zur Lega Lombarda oder die tschechische Historiografie zu den Hussitenkriegen sind dafür weitere anschauliche Beispiele. Und in der marxistischen Geschichtsschreibung war Geschichte nicht nur den gegenwärtigen Interessen, sondern auch einer utopischen Zukunftsvision der klassenlosen Gesellschaft untergeordnet. In all diesen Fällen handelte es sich um die „Historisierung” im Sinne eines Hineintragens der Identitätskämpfe der Gegenwart in die Beschreibung und Deutung der Vergangenheit. Demnach suchten die Historiker/innen in der Vergangenheit die Bestätigung eines gegenwärtigen oder erwünschten Zustands, wobei sie zugleich die Geschichtlichkeit ihres eigenen Standpunkts übersahen und ihre jeweilige, historisch bedingte Form der Darstellung als neutrale Präsentation unzweifelhafter Tatsachen ausgaben. Dies ist genau das, was man heutzutage einen „ahistorischen”, einen „unkritischen” Umgang mit der Vergangenheit nennt.
Die hier skizzierten zwei Dimensionen der „Historisierung” bilden gewissermaßen zwei Gegenpole innerhalb der modernen Geschichtsschreibung: zum einen Geschichtsschreibung als Identitätsstiftung, die eine Brücke schlägt zwischen Gegenwart und Vergangenheit; zum anderen Geschichtsschreibung als Verfremdung und Distanzierung, was bedeutet, einen vermeintlich selbstverständlichen Teil der Wirklichkeit aus seiner „natürlichen” Umgebung herauszunehmen und ihn stattdessen als fremd zu betrachten. Diese Unterscheidung bestimmt unser heutiges Verständnis von Historisierung. Zum Teil wurde sie bereits von Broszat indiziert, indem er die Historisierung als einen – temporären – Bruch mit der eigenen Identität begriff und dafür plädierte, vergangene Erfahrungen in die breiteren gesellschaftlichen und kulturellen Zusammenhänge des jeweiligen Zeitalters einzubetten. Die gesamte moderne Historiografiegeschichte dreht sich also darum, wie diese Spannung zwischen den beiden Polen gestaltet oder überwunden werden kann, wobei ihre jeweilige Gewichtung je nach Kontext variierte. Beide sind allerdings unentbehrliche Operationen für jede Geschichtsschreibung: Auf die anfängliche Verfremdung muss eine Neukontextualisierung folgen, indem man vielfältige Entstehungszusammenhänge für den untersuchten Gegenstand zu identifizieren sucht. Schließlich folgt die „Narrativierung”, also die Formung einer kohärenten Erzählung, welche die durch die Verfremdung entstandene Lücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart wieder zu schließen bemüht ist. Das ist offensichtlich das Schwierigste.[11]
Die Idee der „Überwindung des Eigenen” ist allerdings nicht neu, sondern im gesamten neuzeitlichen Geschichtsdenken präsent. So sollte beispielsweise Rankes berühmtes Diktum, wonach jede Epoche unmittelbar zu Gott sei, nicht als eine Relativierung von Gut und Böse missverstanden werden, wie dies oft geschieht, sondern als Plädoyer für einen (sach-)„gerechten”, in der Tat emanzipatorischen Zugang zur Geschichte. Laut Ranke darf keine historische Periode zur bloßen „Vorgeschichte” herabgesetzt werden, der eine angeblich „bedeutendere” Epoche folgt. Jede Epoche, so Ranke, hat selbst mehrere mögliche „Vorgeschichten” und soll historisch deshalb auch vom Blickwinkel der Vielfalt ihres Herkommens betrachtet werden. Gefordert wird hier also die Anerkenntnis einer grundsätzlichen Neutralität aller Teile des Kontinuums der geschichtlichen Zeit, ja gewissermaßen eine Säkularisierung der historischen Zeit.[12] Historisierung in diesem Sinne betont die Kontinuität sich überlappender Geschichten und postuliert zugleich eine Geschichte mit offenem Ende. Zwar ist klar, dass es immer ein implizit gedachtes Ende gibt, von dem die untersuchungsleitende Frage herrührt: der Untergang der Habsburger Monarchie, die Verbrechen des Nationalsozialismus oder der Zusammenbruch des Kommunismus. Doch bestimmt dieses „Ende” nur die untersuchungsleitende Frage, während die methodische und erzählerische Vielfalt der Forschung und der Darstellung nicht teleologisch eingeebnet werden sollte.
Geschichte mit offenem Ende: Die neuere Alltags- und Kulturgeschichte
Gerade dieses antiteleologische Ideal wurde im späten 20. Jahrhundert durch die Alltags- und Kulturgeschichte wieder aufgegriffen: Als eine Antwort auf die nationalgeschichtlichen, vulgärmarxistischen und modernisierungstheoretischen Großerzählungen (und auf verschiedene Fusionen dieser drei) propagierte die neue Alltags- und Kulturgeschichte die Idee einer nicht-diskriminierenden Perspektive (nicht nur bezüglich der Epochen, sondern auch bezüglich gesellschaftlicher Gruppen) auf eine Geschichte mit offenem Ende.
In der Tat war das Hauptinteresse der neueren Alltags- und Kulturgeschichte an Erfahrungen und Erwartungen der historischen Akteure undenkbar ohne die Veränderung der grundlegenden Erzählperspektive der Geschichtsschreibung. Die „zweifache Konstruktion der historischen Wirklichkeit” ist der Ansatz, der heutzutage den Sinn der Historisierung am prägnantesten erfasst: Ein Ansatz, der die vielfältigen Perspektiven und Denkwelten der historischen Individuen selbst in Betracht zieht, sie aber gleichzeitig in einen übergreifenden Sinnzusammenhang einbettet, dessen sich die historischen Akteure nicht unbedingt bewusst waren. Zugleich befinden sich die Deutungsperspektiven der Historiker selbst ständig in einem Wandel, den es zu reflektieren, ja zu historisieren gilt. Die Beschäftigung mit lokalen Lebenswelten, mit „Unheimlichem”, Ambivalentem oder Marginalisiertem, die Erhebung jener Zeitabschnitte und Ereignisse (oder eben „Nicht-Ereignisse”), die früher als irrelevant galten, zum eigentlichen Mittelpunkt des historischen Interesses zu machen – oder mit Edward P. Thompsons Worten: ihre „Rettung vor der ungeheuren Arroganz der Nachwelt” –, bedeutet keineswegs eine Gleichsetzung der „Geschäfte” mit „Geschichte” und eine Rückkehr der „Antiquitäten”, wie eingewendet werden könnte. Vielmehr geht es um eine Dezentrierung der historischen Erzählung. „Geschäfte” können selbstverständlich nicht mit Geschichte gleichgesetzt werden. Die Alltags- und Kulturhistoriker waren allerdings der Auffassung, dass im Zeitalter der Hochmoderne, d.h. ungefähr zwischen 1860 und 1960, die „Geschäfte” in einem vorher unbekannten Ausmaß durch gewaltige Großerzählungen und scheinbar „allgemein gültige” Erklärungsmodelle selektiert, hierarchisiert und dominiert wurden.
Das heikle Verhältnis zwischen „Geschäften” und „Geschichte” lässt sich gut anhand der Geschichtsschreibung der Politik veranschaulichen. Sie scheint sich lange tatsächlich allzu sehr für die „Geschäfte” im Sinne individueller politischer Entscheidungen und Handlungen interessiert zu haben. Dabei ordnete die Politikgeschichte diese Einzeltatsachen einer festen und scheinbar unveränderlichen Auffassung von politischem Handeln, Macht, Interesse oder Staat unter und verlieh diesen einen eindeutigen, geschichtlichen Sinn. Politische „Geschäfte” wurden in eine staats- und machtzentrierte Großerzählung eingebaut, in der politische Entwicklungen auf einen übergreifenden Zweck ausgerichtet waren, meistens auf die Formierung oder – je nach Art des Narrativs – den Niedergang eines mächtigen Nationalstaates oder Reichs. Im Unterschied dazu untersucht ein im zweiten Sinne „historisierender” Zugang zur Politikgeschichte detailliert, wie „Macht” und „Interessen” durch Sprachgebrauch, Kommunikationspraktiken und symbolische Repräsentationen historisch konstituiert wurden. Ein solcher Zugang interessiert sich auch für andere, lange Zeit scheinbar bedeutungslose „Geschäfte”, wie zum Beispiel die Posen und Gesten der Staatsmänner.
Historisierung und Zeitgeschichte: Geschichtserzählungen des Staatssozialismus und des Nationalsozialismus in Fachwissenschaft und Medienöffentlichkeit
Als Beispiel für einen verengten Begriff der Politik und der Macht auf dem Gebiet der Zeitgeschichtsschreibung lässt sich die Art und Weise herausgreifen, wie die Geschichte der staatssozialistischen Diktaturen in Osteuropa nach ihrem Ende 1989/91 in der Historiografie behandelt wurde. Das nun entstehende Geschichtsbild wurde durch einen Erzählrahmen bestimmt, der zum Teil bereits in den 1980er-Jahren in Dissidentenkreisen Ostmitteleuropas etabliert worden war und nach der „Wende” sowohl die Fachgeschichtsschreibung als auch das kollektive Gedächtnis weitgehend prägte. Als Geschichtserzählung folgt dieses Geschichtsbild einem einfachen Plot:[13]
Erstens besitzt diese Geschichte bezüglich der auftretenden Subjekte eine äußerst bipolare Struktur. Die standardisierten Geschichtsakteure sind das „Regime”, der „Staat” und die „Macht” auf der einen Seite, die „Gesellschaft”, die „Bevölkerung” und die „Öffentlichkeit” auf der anderen Seite. Hauptakteur der Geschichte ist das „Regime”, oft verdinglicht als „Macht”. Die „Macht” handelt quasi wie eine Person: Die Macht realisiert, die Macht entscheidet, die Macht wird überrascht usw. Während die Macht so oft das einzige aktive Agens der Geschichte ist, erscheint die Gesellschaft als ein passives Objekt des Geschehens, eingeschüchtert durch Repression oder manipuliert durch Propaganda. Wo dies nicht der Fall ist, wird ihre Handlung automatisch als „Resistenz” gedeutet, die allerdings als Reaktion auf die Machenschaften der „Macht” zu verstehen ist.
Dabei wird diese Gegenüberstellung von Macht und Gesellschaft zweitens moralisch untermauert durch das manichäische Weltbild, in welchem sich die Kräfte des Guten und des Bösen ohne Möglichkeit auf Versöhnung bekämpfen, wobei letztere mit der „Macht” und erstere mit der „Bevölkerung” identifiziert werden.
Drittens erweist sich die Konzeption der Zeit als radikal teleologisch, d.h. die Geschichte wird als geradliniger Weg der Befreiung der Gesellschaft von der „Macht” dargestellt. Hierbei stehen parlamentarische Demokratie und liberale Marktwirtschaft für das erwünschte Ende der Geschichte, ein gleichsam vorhersehbares Ende, das die gesamte Erzählung determiniert. In Bezug auf die Entfaltung der Nationalgeschichte wird die Epoche des Staatssozialismus als „Abweichung” vom eigentlichen Pfad der Nationalgeschichte, wenn nicht gar, wie im Fall der DDR, als „Fußnote” (Hans-Ulrich Wehler) betrachtet. In dieser Perspektive stellte für Polen der Staatssozialismus eine Abweichung von der Verwirklichung von Freiheit und nationaler Unabhängigkeit dar, für die Tschechoslowakei eine Abweichung von den endogenen demokratischen und egalitaristischen Traditionen, für Ungarn eine Abweichung von der Kontinuität ungarischer Staatlichkeit. Das Jahr 1989 wird in diesen Erzählungen dann folgerichtig als Rückkehr auf die Spur der „richtigen” Entwicklungsschiene gedeutet.
Viertens spielen idiomatische Figuren und Bilder eine wichtige Rolle, die in der Reproduktion dieses Narrativs oft unreflektiert in historische Darstellungen integriert werden oder von einer Darstellung auf die andere überspringen. Die meisten idiomatischen Metaphern stammen aus dem Bereich der Mechanik (die Partei als „Apparat”, die Massenorganisationen als „Transmissionsriemen”, die politischen Zugeständnisse als „Ventil”). Für die Beschreibung von Macht und Ideologie werden aber oft auch Ausdrücke aus der Biologie entlehnt, wie z. B. das Bild des Pilzes, der die Gesellschaft durchwächst und schrittweise paralysiert. Der Erzähleffekt solcher Bilder ist die Naturalisierung sozialer und politischer Verhältnisse und die Eliminierung der sozialen Dimension von Herrschaft sowie der Vielfalt von Erfahrungen.
Eine ähnlich radikale Version solch „ahistorischer” Geschichtserzählungen war jene des historischen Materialismus (Marxismus-Leninismus), wie sie in den Ländern des sowjetischen Blocks vor 1989 praktiziert wurde. Der charakteristischste Zug dieser Erzählung war die berühmt-berüchtigte piatitschlenka, das Fünf-Stufen-Modell der Entwicklung der Gesellschaftsformationen vom Urkommunismus über Sklavenhalterordnung, Feudalismus und Kapitalismus bis zum Kommunismus. Diese schematische Periodisierung, von der es hieß, sie sei durch „eiserne Gesetze der historischen Entwicklung” bestimmt, erscheint uns heutzutage absurd. Allerdings stellt sich die Frage, ob die heutige Geschichtswissenschaft selbst vollkommen frei ist von dieser Art des Geschichtsdenkens. Ist denn nicht das Bedürfnis nach Aufteilung historischer Prozesse in „Entwicklungsstufen”, „Epochen”, „Zäsuren” und „Perioden” der Geschichtsschreibung aller Zeiten gemein? Tatsächlich ist z.B. das Denken in den Kategorien „Altertum”, „Mittelalter”, „Neuzeit” eine Selbstverständlichkeit für die Mehrheit der Fachhistoriker/innen. Es drängt sich jedoch die Frage auf, ob es überhaupt zeitgemäß und sachlich begründbar ist, an diesen Epochenbegriffen festzuhalten, die in unterschiedlichen historischen Konstellationen entstanden sind und andere Wertorientierungen widerspiegeln als unsere gegenwärtigen.
Ein erster Schritt in Richtung einer adäquateren historisch-chronologischen Klassifizierung wäre es, diese Kategorien selbst gründlich zu historisieren, d.h. sie sorgfältig im Kontext ihrer Entstehungsbedingungen zu untersuchen, unter denen vor allem der Humanismus genannt werden muss.[14] Sie setzten sich in einer spezifischen historischen Situation als Klassifizierungsmuster mit bestimmten politischen Zielen und Gebrauchsweisen durch und waren spezifischer Bestandteil der jeweils gegenwärtigen politischen Sprache. „Periodisierung” resultierte aus dem Bedürfnis der Zeitgenossen, politische Brüche und Zeitenwenden zu konstruieren. Die Humanisten taten dies genauso wie später die Liberalen und Sozialisten. Sie alle sahen „neue Epochen” kommen und alte verblassen. Daher stellt sich die Frage, ob wir, wenn wir an der alten Periodisierung festhalten, nicht unsere eigene Historizität verkennen: Stehen wir nicht heute ganz anderen Herausforderungen gegenüber als vor uns Machiavelli, Guizot oder Stalin?
Angesichts dieser Unsicherheit sollte etwa der Glaube marxistischer Historiker/innen an „Entwicklungsstufen” und die „Gesetzmäßigkeit des historischen Prozesses”, an die Vereinbarkeit von wissenschaftlicher Objektivität und kommunistischer Parteilichkeit nicht als Naivität verspottet oder als böse Propaganda verurteilt werden. Es ist recht einfach, die Maßstäbe der westlichen pluralistischen Wissenschaft an die marxistisch-leninistische Historiografie anzusetzen, um den „Abweichungsgrad” von der angeblichen Norm festzustellen. Dies mag zwar dazu dienen, uns selbst unserer Identität als Anhänger westlicher Wissenschaftlichkeit zu vergewissern oder Rezepte für unsere eigene „Verbesserung” zu liefern, sagt aber nur wenig über das historische Denken unter den Bedingungen der staatssozialistischen Diktatur aus. Statt die kommunistische Historiografie für die Verzerrung der Geschichte zu verklagen, würde ein dem „historisierenden Ansatz” treuer Historiker diese in ihren mannigfaltigen Entstehungskontext einbetten, das Selbstverständnis staatssozialistischer Gesellschaften beachten, die diskursiven und institutionellen Mechanismen sowie die vorherrschenden Denkmuster und Wertorientierungen ihrer Historiker/innen untersuchen und deren spezifische Begriffe von Wahrheit, Erkenntnis und Objektivität in Betracht ziehen. Er oder sie würde nicht nur auf den „ideologischen Druck” schauen, der Ansichten erzwingen konnte, sondern auch subtile Sprachmechanismen erforschen, mit denen „Klarheit” und „Meinungseinheit” erreicht wurden.
Eine weitere Bemerkung betrifft das Verhältnis zwischen einer solchen „reflektierten Historisierung” und den öffentlichen Debatten über die jüngste Vergangenheit. Wie die Erfahrungen der Historiker/innen in postdiktatorischen Gesellschaften zeigen, ist es keine leichte Aufgabe, eine im hier skizzierten Sinne differenzierte Darstellung diktatorischer Vergangenheit einem breiteren Publikum zu vermitteln. Auch wenn es in letzter Zeit zu einem gewissen „Aufweichen” des lange dominierenden Totalitarismus-Paradigmas in der Forschung über die staatssozialistischen Systeme in Osteuropa kam, ist es nach wie vor dieses macht- und repressionszentrierte Geschichtsbild, das die öffentliche Erinnerungskultur – trotz aller Pluralisierungstendenzen der letzten Zeit – weitgehend beherrscht. Während „Historisierung” als kognitive und narrative Strategie ein subversives Potenzial besitzt und eine Herausforderung für affirmative Identitätserzählungen in der Fachhistoriografie darstellt, ist sie vergleichsweise schwach und zahnlos, wenn es darum geht, die Politik und die Medien von ihren Vorteilen zu überzeugen. Durch die Gründung der „Institute für Nationalgedenken” in mehreren Ländern Ostmitteleuropas (bislang Polen, die Slowakei, Tschechien) erhielten vereinfachende, mit einem politisch-moralisierenden Unterton schwer belastete Geschichtsbilder eine staatlich-institutionelle, geschichtspolitische Sanktionierung. Dies sollte allerdings keineswegs vereinfachend auf angebliche „Transformationsdefizite” der postkommunistischen Länder im Bereich der sogenannten Vergangenheitsbewältigung zurückgeführt werden. Auch in Deutschland löste nämlich beispielsweise noch im Jahr 2006 ein Expertenbericht, der einen differenzierenden Umgang mit der Geschichte der SED-Diktatur forderte und die Vielschichtigkeit und Uneindeutigkeit der Erfahrungen unter der Diktatur hervorhob, heftige Kontroversen aus, nachdem der konservative Staatskulturminister ihn abgelehnt hatte.[15]
Hier zeigen sich letztlich gewisse Ähnlichkeiten mit der Debatte um die Historisierung des Nationalsozialismus der 1980er-Jahre, die auch die moralischen Grenzen der Historisierung – und damit die Historisierung als moralisches Problem – deutlich machte. Ähnlich wie bei den Alltagshistoriker/innen, die nach 1989 gegen den Totalitarismusbegriff bei der Aufarbeitung des Staatssozialismus argumentierten, war es auch in der „Historisierungsdebatte” der 1980er-Jahre vor allem darum gegangen, die untersuchte Epoche – den Nationalsozialismus – nicht als das identitätsstiftende „Andere” wahrzunehmen, weil darin die Gefahr erblickt wurde, dass die Periode des Nationalsozialismus aus der Kontinuität der deutschen Geschichte herausgelöst und damit eine Exkulpation der Deutschen vorgenommen werden könnte. Ein Teil der Historisierung war auch die Infragestellung des totalitaristischen Herrschaftsbegriffs durch regional- und alltagsgeschichtliche Forschung, welche die dichotome Gegenüberstellung von Herrschaft und Gesellschaft und simplifizierende Aktions-Reaktions-Schemata kritisierte. Stattdessen deuteten die Alltagshistoriker/innen die NS-Herrschaft als soziale Praxis, die ein breites Spektrum von Handlungen wie beispielsweise die aktive Teilnahme oder das Mit-Machen, das Verweigern oder das Sich-Entziehen mit einbezog. Ein wichtiger Streitpunkt der „Historisierungsdebatte” allerdings war, dass viele, die eine „Historisierung” des NS befürworteten, darunter auch Broszat selbst, das zentrale Ereignis dieser Zeit, nämlich den Holocaust, in ihrer Betrachtung beiseitegelassen hatten. Dies war auch der Grund dafür, warum Saul Friedländer Broszats Historisierungsprojekt kritisierte. Der Streit drehte sich demnach um die Frage, was das eigentliche „Ende” der zu erzählenden Geschichte sei, von dem die untersuchungsleitende Frage ausgehen sollte: die „deutschte Katastrophe” – oder die Ermordung der europäischen Juden?[16]
Hinsichtlich der Rolle der Fachgeschichtsschreibung in der breiteren Erinnerungskultur der Gegenwart wird jedenfalls offensichtlich, dass „Historisierung”, die eine Fragmentierung identitätsstiftender Großerzählungen anstrebt, die individuelle wie kollektive Erinnerungen ernst nimmt und die den dialogischen Charakter der Rekonstruktion der Vergangenheit betont, eher schwer in der medial strukturierten Öffentlichkeit vermittelbar ist. Die Erfahrungen der postkommunistischen Länder vor allem in den 1990er-Jahren haben gezeigt, wie begrenzt die Möglichkeiten derjenigen Historiker/innen waren, die ein alternatives Bild zur Großerzählung des Totalitarismus in der Politik und den Medien akzeptabel zu machen erstrebten, wo nach wie vor eine starke Nachfrage nach Quellen der kollektiven Identität und eher affirmativen als kritischen Ansätzen besteht. Dies war aber zeitgleich auch für „westliche Gesellschaften” nicht grundsätzlich anders, wie letztlich auch die Geschichtsdebatten in Deutschland offenbarten. So ist das von Michael Geyer und Konrad H. Jarausch benutzte Sprachbild des „zerbrochenen Spiegels” für die neueste deutsche Geschichte sicherlich ein herausforderndes intellektuelles Projekt,[17] doch scheint es nicht gerade Oberhand über die neuen „kohärenten” deutschen Geschichtserzählungen zu gewinnen, die immer wieder neue Konjunkturen erleben.[18] In den meisten europäischen Ländern, keineswegs nur postkommunistischen, werden identitätsstiftende grand narratives weiterhin ungestört erzählt, oft auch von professionellen Historiker/innen: „Lange Wege” zu erträumten Paradiesen bleiben offenbar attraktiver als zerbrochene Spiegel. Die Antwort auf die Frage, warum dem so ist, müssen die „historisierenden Historiker/innen” immer wieder aufs Neue suchen.
Empfohlene Literatur zum Thema
Benedetto Croce, Zur Theorie und Geschichte der Historiographie, Mohr, Tübingen 1915.
Johann Gustav Droysen, Historik : historisch-kritische Ausgabe, Bd.1: Rekonstruktion der ersten vollständigen Fassung der Vorlesungen (1857). Grundriß der Historik in der ersten handschriftlichen (1857/1858) und in der letzten gedruckten Fassung (1882), Frommann-Holzboog, Stuttgart 1977, ISBN 3-7728-0676-7.
Johann Gustav Droysen, Historik : historisch-kritische Ausgabe, Bd.2: Texte im Umkreis der Historik, Frommann-Holzboog, Stuttgart 2007.
Norbert Frei (Hrsg.), Martin Broszat, der "Staat Hitlers" und die Historisierung des Nationalsozialismus, Wallstein, Göttingen 2007, ISBN 3-8353-0184-5.
Saul Friedländer, Ein Briefwechsel, fast zwanzig Jahre danach, in: Norbert Frei (Hrsg.), Martin Broszat, der "Staat Hitlers" und die Historisierung des Nationalsozialismus. Wallstein, Göttingen 2007, ISBN 3-8353-0184-5, S. 188-194.
Mary Fulbrook, Approaches to German Contemporary History since 1945: Politics and Paradigms, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History, Online-Ausgabe, 1 (2004). Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, ISSN 1612-6033, S. 31-50 (online).
Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Ullstein, Frankfurt a. M. 1972, ISBN 3-548-02929-9.
Konrad H. Jarausch, Michael Geyer, Zerbrochener Spiegel. Deutsche Geschichten im 20. Jahrhundert, DVA, München 2005, ISBN 3-421-05673-0.
Theodor Lessing, Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen, Rütten & Loening, Hamburg 1962.
Arnaldo Momigliano, Ancient History and the Antiquarian, in: Arnaldo Momigliano (Hrsg.), Studies in Historiography. Weidenfels & Nicolson, London 1966, S. 1-39.
Wolfgang J. Mommsen (Hrsg.), Leopold Ranke und die moderne Geschichtswissenschaft, Klett-Cotta, Stuttgart 1988, ISBN 3-608-91472-2.
Theodor Mommsen, Römische Geschichte, 8 Bde., dtv, München 1976.
Glenn W. Most (Hrsg.), Historicization, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2001, ISBN 3-525-25904-2.
Martin Sabrow, Rainer Eckert, Monika Flacke (Hrsg.), Wohin treibt die DDR-Erinnerung? Dokumentation einer Kontroverse, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2007, ISBN 978-3-525-36299-0.
Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Mohr, Tübingen 1985, ISBN 3-16-544996-1.
Hartmut Westermann, Epochenbegriffe und Historisierung. Ein Gespräch mit Kurt Flasch, in: Internationale Zeitschrift für Philosophie. 2 (2004).
Hayden V. White, Metahistory, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1973, ISBN 0-8018-1469-3.
Heinrich A. Winkler, Der lange Weg nach Westen. 2 Bde., Beck, München 2000, ISBN 3-406-46001-1.
Pavel Kolář, Historisierung, Version: 2.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 22.10.2012, URL: http://docupedia.de/zg/Historisierung_Version_2.0_Pavel_Kol.C3.A1.C5.99
Copyright (c) 2023 Clio-online e.V. und Autor, alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk entstand im Rahmen des Clio-online Projekts „Docupedia-Zeitgeschichte“ und darf vervielfältigt und veröffentlicht werden, sofern die Einwilligung der Rechteinhaber vorliegt. Bitte kontaktieren Sie: <redaktion@docupedia.de>
Anmerkungen
- ↑ Norbert Frei (Hrsg.), Martin Broszat, Der „Staat Hitlers“ und die Historisierung des Nationalsozialismus, Göttingen 2007.
- ↑ Glenn W. Most (Hrsg.), Historicization, Göttingen 2001.
- ↑ Momigliano unterscheidet zwischen Geschichte und Antiquitäten folgendermaßen: „1) historians write in a chronological order; antiquaries write in a systematic order; 2) historians produce those facts which serve to illustrate or explain certain situations; antiquaries collect all the items that are connected with a certain subject, whether they help to solve the problem or not.“ Arnaldo Momigliano, Ancient History and the Antiquarian, in: Studies in Historiography, London 1969, S. 1-39, hier S. 3.
- ↑ Johann Gustav Droysen, Historik. Historisch-kritische Ausgabe, hrsg. v. Peter Leyh,, Bd. 1, Stuttgart-Bad Cannstatt 1977; Bd. 2: Stuttgart 2007; Theodor Lessing, Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen, Hamburg 1962; Hayden White, Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe, Baltimore 1973.
- ↑ Droysen, Historik, Bd. 1, S. 69.
- ↑ Siehe seine Aufsätze „Der Sinn der Wertfreiheit“ und „Objektivität sozialwissenschaftlicher Erkenntnis“, in: Johannes Winckelmann (Hrsg), Max Weber. Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen 1985.
- ↑ Johann Wolfgang von Goethe, Faust, Kehl 1994, S. 37.
- ↑ Benedetto Croce, Zur Theorie und Geschichte der Historiographie, Tübingen 1915.
- ↑ Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Frankfurt a.M. 1972, S. 14.
- ↑ Theodor Mommsen, Römische Geschichte, 8 Bde., München 1976.
- ↑ Glenn W. Most, Vorwort in ders. (Hrsg.), Historicization, S. VII-XII, hier S. VIII.
- ↑ Siehe Wolfgang J. Mommsen, Leopold Ranke und die moderne Geschichtswissenschaft, Stuttgart 1988.
- ↑ Mary Fulbrook, Approaches to German Contemporary History since 1945: Politics and Paradigms, in: Zeithistorische Forschungen 1 (2004), H. 1, S. 31-50, Online-Ausgabe, http://www.zeithistorische-forschungen.de/site/40208147/default.aspx.
- ↑ Dies fordert der Philosoph Kurt Flasch, siehe Hartmut Westermann, „Epochenbegriffe und Historisierung. Ein Gespräch mit Kurt Flasch “, in: Internationale Zeitschrift für Philosophie 2 (2004), S. 193-209.
- ↑ Martin Sabrow/Rainer Eckert/Monika Flacke, Wohin treibt die DDR-Erinnerung, Göttingen 2007.
- ↑ Saul Friedländer, „Ein Briefwechsel, fast zwanzig Jahre danach“, in: Frei (Hrsg.), Martin Broszat, der „Staat Hitlers“ und die Historisierung des Nationalsozialismus, S. 188-194.
- ↑ Konrad H. Jarausch/Michael Geyer, Zerbrochener Spiegel. Deutsche Geschichten im 20. Jahrhundert, München 2005.
- ↑ Siehe vor allem Heinrich A. Winkler, Der lange Weg nach Westen, 2 Bde., München 2000.