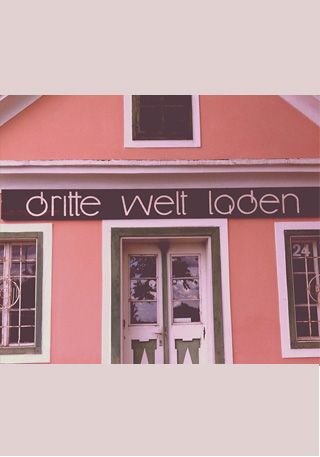1. Einleitung
Das Ordnungsmuster der „Dritten Welt”[1] entstand nach dem Zweiten Weltkrieg im Spannungsfeld von drei globalen Prozessen.[2] Im Zuge der dritten Welle der Dekolonisierung endete erstens die politische Vormachtstellung Europas über weite Teile der nicht-europäischen Welt. Die Entstehung zahlreicher neuer asiatischer und afrikanischer Staaten stellte die Weltbilder der europäischen Gesellschaften in Frage und weckte zugleich das Bedürfnis nach neuen Ordnungskategorien der Welt.[3] Verstärkt wurde dieses Anliegen zweitens dadurch, dass sich die meisten Regierungen postkolonialer Staaten der bipolaren Logik des Kalten Kriegs widersetzten. In der Auseinandersetzung zwischen demokratisch-kapitalistischem „Westen” und kommunistischem „Osten” ließen sie sich nicht eindeutig verorten. Sie stellten daher einen vermeintlich von beiden Lagern unterscheidbaren „dritten Raum” dar, der schnell den Hauptschauplatz des Kalten Kriegs markierte beziehungsweise zu einem „revolutionären Subjekt” avancierte, das einen „dritten Weg” aus dem Ost-West-Konflikt zu weisen schien oder auf das zumindest Hoffnungen für eine Umgestaltung der internationalen Ordnung projiziert werden konnten.[4] Schließlich galten die Länder Asiens, Afrikas und Lateinamerikas mit der globalen Durchsetzung modernisierungstheoretischer Annahmen, der Herausbildung einer amerikanisch dominierten Weltwirtschaftsordnung und dem Beginn entwicklungspolitischer Großprojekte gegenüber den Industrieländern der nördlichen Halbkugel als wirtschaftlich rückständig. Diese als „Unterentwicklung” bezeichnete wirtschaftliche Struktur wurde zu einem weiteren zentralen Merkmal der Länder der „Dritten Welt”.[5]
Die Dritte Welt hat es – ebenso wie den Westen oder den Osten – nur als abstraktes wirkmächtiges zeitgenössisches Ordnungsmuster der Welt gegeben. Ihre jeweiligen Definitionen waren nicht trennscharf, sondern diffundierten an ihren Rändern aus. Die entsprechende Aufladung des schillernden Dritte Welt-Begriffs basierte zugleich nicht immer auf realen Entwicklungen in diesen Ländern, sondern auch auf der Phantasie der Sprechenden und konnte so koloniale Idealisierungen und Stereotype in das postkoloniale Zeitalter überführen. Je nachdem, welche Merkmale einzelne Sprecher hervorhoben, existierten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verschiedene Definitionen und Vorstellungen von der Dritten Welt, wodurch jeweils unterschiedliche Länder als Prototypen davon erschienen. Der Begriff oszillierte zwischen Selbst- und Fremdbeschreibung, wodurch er an zeitgenössische Diskurse anschlussfähig war und es den Zeitgenossen ermöglichte, den (geo-)politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Wandel der globalen Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg begrifflich zu fassen, mit Sinn zu versehen und zu gestalten.
Der Begriff der Dritten Welt wurde von imaginären und tatsächlichen Entwicklungen in den Ländern Asiens und Afrikas sowie zum Teil auch Lateinamerikas geprägt. Deshalb soll zunächst die politische und wirtschaftliche Geschichte dieser an sich sehr unterschiedlichen Länder, die als typisch für die Dritte Welt erschienen, sowie ihr Agieren in den internationalen Beziehungen knapp skizziert werden. Deren Geschichte bot Anknüpfungs- und Ausgangspunkte für bestimmte Deutungen der Dritten Welt. Sie rief zwar nicht zwangsläufig bestimmte Interpretationen hervor, die Entstehung mancher Sichtweisen auf die Dritte Welt lassen sich allerdings – unter Bezug auf die Geschichte ihrer Länder– besser verstehen. Um den imaginierten Zuschnitt der Dritten Welt und die damit verbundenen Deutungen und Semantiken sowie deren wechselvolle Geschichte geht es dann im zweiten Teil, der verschiedene westliche Sichtweisen auf die Dritte Welt aufzeigt. Abschließend werden das neue Interesse der Geschichtswissenschaft an der Dritten Welt und aktuelle Forschungsdebatten knapp skizziert sowie Perspektiven für weitere Studien aufgezeigt.
2. Grundzüge der Dritten Welt
2.1 Politik und Wirtschaft in Asien und Afrika
Die politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Divergenzen zwischen den Ländern Asiens und Afrikas sind groß. Gleichwohl gibt es aufgrund ihrer kolonialen Vergangenheit und ihrer nahezu zeitgleichen Unabhängigkeit im Kontext des Ost-West-Konflikts auch Gemeinsamkeiten zwischen ihnen, die im Folgenden beschrieben werden.
In einem angesichts der langen Dauer kolonialer Herrschaft überraschend kurzen Zeitraum endete nach dem Zweiten Weltkrieg die politische Herrschaft Europas über weite Teile der nicht-europäischen Welt. In der Kernphase der „dritten Welle” der Dekolonisierung, beginnend mit der Unabhängigkeit Indiens im Jahr 1947 und endend mit dem Rückzug Portugals aus seinen afrikanischen Kolonien im Jahr 1975, entstanden weltweit über einhundert neue Staaten. Auf dem afrikanischen Kontinent erreichte die Dekolonisierung ihren Höhepunkt im sogenannten Afrikajahr 1960, als 17 Kolonien ihre Unabhängigkeit erhielten. Der damit verbundene Machttransfer war zum Teil zwischen Kolonialmacht und postkolonialer Elite friedlich ausgehandelt oder von der antikolonialen Bewegung gegen den Willen der Kolonialmacht in mehrjährigen Kämpfen erzwungen worden.
Mit dem Flaggenwechsel veränderten sich radikal die Lebenswelten von Millionen Menschen, die sich in neu gegründeten (National-)Staaten wiederfanden, deren Grenzen von den Kolonialmächten mit dem Lineal und oftmals willkürlich gezogen worden waren und deren politisch-administratives Erbe die postkolonialen Regierungen mit dem neuen Staat übernahmen. Auch die Volkswirtschaften der postkolonialen Staaten waren noch als Folge der Kolonialzeit vor allem auf die Produktion und den Export von (einzelnen) Rohstoffen ausgerichtet, ausländische Unternehmen besaßen große Teile der Produktionsstätten, und in der eigenen Gesellschaft fehlte häufig das nötige Wissen und Kapital zur Modernisierung. Vor diesem Hintergrund musste sich die neue Elite nach innen gegenüber einer heterogenen und schnell wachsenden Bevölkerung und nach außen gegenüber anderen Staaten als souveräner Herrscher etablieren und legitimieren sowie die Versprechen des antikolonialen Kampfes, insbesondere nach Entwicklung und Wohlstand, unter extrem ungünstigen Rahmenbedingungen einlösen.[6]
Die neuen Machthaber stützten ihre Herrschaft zunächst auf ihr während des antikolonialen Kampfes erworbenes Prestige, auf mächtige persönliche Netzwerke, das Militär oder die Unterstützung der ehemaligen Kolonialmacht. Innenpolitisch schlugen sie unterschiedliche Wege ein, deren Spektrum über den Aufbau demokratischer Strukturen bis hin zur Errichtung von Diktaturen reichte. Weitgehend unabhängig vom gewählten politischen System griffen nahezu alle postkolonialen Regierungen auf die Annahmen der Modernisierungstheorie sozialistischer oder westlicher Prägung zurück. Durch massive staatliche Interventionen, durch forcierte Landreformen, mit Hilfe von technokratischen und wissenschaftlichen Expertisen und durch großangelegte Entwicklungsprojekte versuchten sie, die Wirtschaft ihrer Länder anzukurbeln. Auf die betroffene Bevölkerung und Umwelt wurde dabei selten Rücksicht genommen, sodass die jeweiligen Maßnahmen oft katastrophale soziale und ökologische Folgen nach sich zogen. Einzelne Regierungen entschieden sich, um die Entwicklung ihres Landes zu forcieren, für die Nationalisierung ausländischer Unternehmen, womit sie zugleich auf Konfrontationskurs zu den westlichen Industrieländern gingen.[7]
Außenpolitisch bemühten sich die neuen Regierungen in der Regel jedoch darum, nicht eindeutig Partei im Konflikt zwischen der Sowjetunion und den USA zu ergreifen. Die beiden Supermächte versuchten wiederum, durch zahlreiche Maßnahmen Einfluss auf die postkolonialen Regierungen zu nehmen und diese im Ost-West-Konflikt auf ihre Seite zu ziehen. Auf den dadurch erzeugten politischen und ökonomischen Druck reagierten zahlreiche postkoloniale Staaten mit einer Politik der Bündnisfreiheit. Anstatt sich einem Lager und der entsprechenden Führungsmacht unterzuordnen, versuchten die bündnisfreien Regierungen, den Gegensatz zwischen Ost und West auszunutzen, um beide Lager gegeneinander auszuspielen und die „Pokerdividende” dieses Konflikts einzustreichen. Bündnisfreiheit kann somit als Strategie einiger postkolonialer Staaten verstanden werden, um ihren politischen Handlungsspielraum nach innen wie außen zu vergrößern.[8]
Mit zunehmendem zeitlichen Abstand zur Unabhängigkeit machten die meisten postkolonialen Regierungen die Erfahrung, dass sie mit der Dekolonisierung zwar einerseits völkerrechtlich souveräne Staaten repräsentierten und neue politische und wirtschaftliche Handlungsspielräume erlangt hatten. Andererseits zeigte sich, dass diese neuen Spielräume innenpolitisch durch die Übernahme und auf internationaler Ebene durch das Fortdauern kolonialer Strukturen stark eingeschränkt waren. Die postkolonialen Staaten waren zwar wirtschaftspolitisch souverän, zugleich aber mit der Weltwirtschaft vernetzt und häufig von dieser abhängig. Außenpolitisch beschnitt zudem der Ost-West-Konflikt den Aktionsradius der neuen Regierungen, die sich sowohl gegenüber den beiden Kontrahenten des Kalten Kriegs als auch gegenüber den ehemaligen Kolonialmächten, von deren Entwicklungshilfe sie häufig abhängig waren, behaupten mussten.[9]
Als sich daher die mit der politischen Unabhängigkeit verbundenen politischen und ökonomischen Erwartungen nicht erfüllten, dauerte es nicht lange, bis unter der postkolonialen Elite die Bereitschaft zu autoritäreren Formen der Herrschaft und zur gewaltsamen Lösung von wahrgenommenen Entwicklungsproblemen stieg. Gleichzeitig gewannen im Handeln der neuen Regierungen historische und ökonomische Modelle wie die Dependenz-Theorie an Einfluss und Überzeugungskraft, welche die Gründe für die andauernden Probleme und ausbleibenden wirtschaftlichen Erfolge in ihren Ländern in den internationalen Rahmenbedingungen, deren ungerechten Strukturen und dem Agieren anderer Staaten und Organisationen sahen und weniger in der Politik der postkolonialen Regierungen. Die Reform der internationalen Ordnung wurde damit zu einem notwendigen und erklärten Ziel postkolonialer Regierungen, die sich hierfür immer wieder in unterschiedlichen Formen zur internationalen Kooperation zusammenfanden.[10]
2.2 Die Länder Asiens, Afrikas und Lateinamerikas in den internationalen Beziehungen
Die postkolonialen Regierungen konnten auf eine lange Tradition antikolonialer Zusammenarbeit zurückblicken. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts manifestierte sie sich beispielsweise in den verschiedenen Pan-Bewegungen oder in der Liga gegen Imperialismus und für nationale Unabhängigkeit (1927-1937).[11] An diese Tradition knüpften die neuen Regierungen bei ihren ersten Versuchen der postkolonialen Kooperation nach dem Zweiten Weltkrieg an. Im April 1955 trafen sich 23 asiatische und 6 afrikanische Regierungen zur Asiatisch-Afrikanischen Konferenz in Bandung. Auf dieser weltweit beachteten Konferenz forderten sie zusätzlich zur sofortigen Unabhängigkeit aller Kolonien, ihre internationale Anerkennung als souveräne Regierungen, ihre Aufnahme in die Vereinten Nationen sowie ihr gleichberechtigtes Mitspracherecht in internationalen Fragen.
![Bandung 1955, Prinz Faisal von Saudi Arabia (Erster von links), Gamal Abdel Nasser, Imam Ahmad Nordjemen und Mohamad Amin al-Husayni, Urheber: Dar al-Hilal, Fotograf nicht bekannt, Quelle: [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nasser-Faisal-Husayni_at_Bandung.png?uselang=de Wikimedia Commons] ([http://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain?uselang=de gemeinfrei]).](sites/default/files/import_images/1484.jpg)
Die Bandung-Konferenz war Produkt und Kristallisationspunkt der ablaufenden Dekolonisierungsprozesse und zugleich ein kraftvoller Impuls, welcher der Dekolonisierung neue Dynamik verlieh. Die Konferenz stellte einen Moment des Wandels dar, der Anführer antikolonialer Bewegungen in postkoloniale Regierungen transformierte, diese international hör- und sichtbar machte und damit Vorstellungen einer erwachenden Dritten Welt mit Inhalt füllte. Zugleich rückte Bandung die postkolonialen Länder in das Blickfeld der Sowjetunion und der USA. Beide Großmächte erhöhten daraufhin den Druck auf die afroasiatischen Regierungen, sich im Systemkonflikt zu positionieren, was wiederum Ende der 1950er-Jahre zur Entstehung postkolonialer bündnisfreier Staaten führte, die sich weigerten, sich in einem Lager zu verorten.[12] Auf dem Höhepunkt des Ost-West-Konflikts im September 1961 bestätigten 25 Regierungsoberhäupter, darunter Nehru, Nasser, Nkrumah und Tito, auf einer Konferenz in Belgrad ihre Politik der Bündnisfreiheit.[13]
Gleichzeitig forderten sie die Industriestaaten zu Gesprächen über eine Reform der Weltwirtschaftsordnung auf. Dies führte im Jahr 1964 zur United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), der bis dahin größten globalen Wirtschaftskonferenz, auf der Industrie- und Entwicklungsländer den Aufbau der Weltwirtschaft diskutierten. Unter Bezug auf Raúl Prebisch und dessen Dependenztheorie kritisierten die Regierungen der Entwicklungsländer die wirtschaftspolitischen Abhängigkeiten ihrer Staaten von den Industrienationen und forderten eine Reform der internationalen Wirtschaftsordnung.[14] Während der Verhandlungen schlossen sich dann asiatische, afrikanische, lateinamerikanische Länder und Jugoslawien zur Gruppe der 77 zusammen. Sie verstanden sich als Interessensvertretung der Entwicklungsländer, wodurch sie die Unterschiede zwischen sich und den Industrieländern akzentuierten. Gleichzeitig institutionalisierten sie den Interessensgegensatz zwischen den „armen” und „unterentwickelten” Ländern der südlichen Hemisphäre und den „reichen” Industriestaaten der nördlichen. Sie schufen damit die Grundlage für eine Deutung der Weltpolitik, die mittelfristig unter dem Schlagwort des Nord-Süd-Konflikts die internationalen Beziehungen der 1960er- und 1970er-Jahre prägen sollte.
Zuvor kam es im Jahr 1966 vor dem Hintergrund des eskalierenden Vietnamkriegs in der kubanischen Hauptstadt Havanna zur Trikontinentalen Konferenz mit Fidel Castro, Salvador Allende und Ernesto Ché Guevara, die ebenso wie die anderen Teilnehmer die internationale Lage durch den Widerspruch zwischen imperialistischen Kräften einerseits und den unterdrückten Nationen und Völkern der südlichen Halbkugel andererseits gekennzeichnet sahen. Dieser Konflikt war ihnen zufolge jedoch nicht im Dialog, sondern nur durch Gewalt zu lösen. Diesem Aufruf zur Gewalt folgte nur eine Minderheit der Teilnehmer, gleichwohl prägte er in den 1960er-Jahren weltweit in bestimmten Milieus die Wahrnehmung der Dritten Welt. Die meisten postkolonialen Regierungen versuchten jenseits aller Rhetorik, ihre politischen und wirtschaftlichen Ziele, auch angesichts der enormen militärischen Übermacht der westlichen Staaten, auf friedlichem Wege und durch Verhandlungen zu erreichen.[15]
Zur dauerhaften globalen Zusammenarbeit der postkolonialen Länder außerhalb der Vereinten Nationen kam es in den 1970er-Jahren, als sich nahezu alle Staaten Asiens, Afrikas und Lateinamerikas aus Enttäuschung über die spärlichen Ergebnisse der ersten UNCTAD-Verhandlungen sowie aufgrund ihres Ausschlusses aus den KSZE-Verhandlungen in der Bewegung Bündnisfreier Staaten zusammenschlossen. Angesichts des Zusammenbruchs des Bretton-Woods-Systems und angespornt durch die ersten Erfolge der OPEC-Staaten erhofften sich zahlreiche Regierungen bündnisfreier Länder, durch eine Kooperation mit anderen Staaten den Wandel der internationalen Beziehungen aktiv gestalten zu können. Durch ihr gemeinsames Auftreten in den Vereinten Nationen zusammen mit der G77 und den Ausbau von Süd-Süd-Beziehungen machten die Bündnisfreien in den folgenden Jahren den Nord-Süd-Konflikt zum zentralen Thema der internationalen Politik. Dabei verstand sich die Bewegung selbst als politische Vertretung der Dritten Welt und wurde von den Regierungen der nördlichen Halbkugel auch als diese wahrgenommen.[16]
Die herausgehobene Stellung der Bewegung unter den Institutionen der postkolonialen Regierungen hielt nicht lange an. Bereits in den 1970er-Jahren forderte die VR China deren Vertretungsanspruch nach dem Ende der Kulturrevolution heraus. Die Volksrepublik entwickelte ein eigenes Drei-Welten-Modell, in dem China an der Spitze der Dritten Welt stand.[17] Schwerwiegender war jedoch, dass innerhalb der heterogenen Koalition der Bündnisfreien die Divergenzen zwischen den einzelnen Mitgliedsländern zunahmen. Mit dem sogenannten Zweiten Kalten Krieg, der zweiten Ölpreiskrise und der folgenden Verschuldungskrise kam es zur Polarisierung zwischen den Staaten Asiens, Afrikas und Lateinamerikas. Unter anderem standen sich pro-östliche und pro-westliche Regierungen, arabische Staaten und Ägypten sowie ressourcenarme und (rohstoff)reiche Staaten wie die OPEC- und asiatischen „Tiger-Staaten” gegenüber, da sich ihre unterschiedlichen politischen und wirtschaftlichen Interessen kaum mehr auf einen Nenner bringen und in gemeinsamen politischen Forderungen zusammenfassen ließen.
In den 1980er-Jahren wandten sie sich von Ansätzen globaler multilateraler Weltpolitik ab und gingen zu kleinteiligen regionalen oder bilateralen Kooperationen über. Es kam zu einem Revival alter Panideologien, und Entwicklungsländer mit stark wachsenden Volkswirtschaften schlossen sich in neuen kleineren Staatengruppen zusammen. Im Jahr 2003 gründeten sich sowohl die G20 Staatengruppe als auch das India-Brazil-South Africa Dialogue Forum (IBSA), dem sich später noch Russland und China (BRICS) anschlossen. Heutzutage konkurrieren eine Vielzahl an religiösen, regionalen und monothematischen Organisationen um Einfluss unter den Ländern der südlichen Halbkugel. Letztendlich ist es jedoch nicht gelungen, eine zentrale Institution der asiatischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Staaten zu etablieren oder eine eigene Kollektivbezeichnung für diese durchzusetzen. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es unterschiedliche Kooperationsversuche mit variierender inhaltlicher Schwerpunktsetzung. Die versammelten Regierungen sprachen mal im Namen der afroasiatischen Staaten, mal im Auftrag aller bündnisfreien Staaten, mal im Zeichen des Trikont und mal als Vertretung der Entwicklungsländer, was verschiedene Wahrnehmungsweisen dieser Länder begünstigte und bis in die Gegenwart hinein begünstigt.[18]
3. Semantiken der Dritten Welt und ihre Aneignung im Westen
3.1 Entstehung und Verbreitung des Begriffs
Der Begriff der „Dritten Welt” entstand in Westeuropa.[19] Als Wortschöpfer gilt der französische Demograf und Direktor des Institut National d'Études Démographiques Alfred Sauvy (1898-1990), der am 14. August 1952 in der Zeitung „L'Observateur” einen Artikel mit der Überschrift „Trois mondes, une planète” publizierte.[20] Als Dritte Welt bezeichnete Sauvy dabei einerseits einen von Ost und West geopolitisch unterscheidbaren „unterentwickelten”, aber entwickelbaren Raum mit kolonialer Vergangenheit, in dem die erste demokratisch-kapitalistische und die zweite sozialistische Welt um Einfluss konkurrierten, um die Überlegenheit ihrer Gesellschaftssysteme zu beweisen. Andererseits gestand er der Dritten Welt Subjektcharakter und Akteursqualitäten zu. Allein angesichts des enormen Bevölkerungswachstums in den asiatischen und afrikanischen Ländern stand für den Demografen Sauvy der Eintritt der Dritten Welt in die internationale Politik außer Frage. Semantisch an die Sprache der französischen Revolution anknüpfend, prognostizierte er in der bekanntesten Passage seines Artikels: „Denn endlich verlangt auch diese Dritte Welt, die wie der Dritte Stand übergangen wird, die ausgebeutet und verachtet ist, etwas zu sein.”[21] Der von Sauvy eingeführte schillernde und mehrdeutige Begriff der Dritten Welt schloss an verschiedene zeitgenössische Diskurse an, was zu dessen rascher Verbreitung führte. Der Begriff verwies auf die ablaufende Entkolonialisierung, auf das enorme Bevölkerungswachstum in den postkolonialen Ländern und auf einen dritten Weg im Ost-West-Konflikt.
Nach Sauvys Artikel popularisierten Georges Balandier, Jean Baumier und Jean Lacouture den Begriff in Frankreich, der kontinuierlich in verschiedene Wissenschaftsdisziplinen und nach und nach in verschiedene Sprachen diffundierte. Anfang der 1960er-Jahre erschienen die ersten Publikationen in englischer, schwedischer und deutscher Sprache, welche die Begriffe „Third World”, „Tredje Världen” und „Dritte Welt” verwendeten.[22] Ende der 1960er-Jahre taucht der Begriff dann auch in russischsprachigen Publikationen auf, und gleichzeitig begann ihn die chinesische Regierung zu benutzen.[23] Spätestens in den 1970er-Jahren dann sprachen auch die postkolonialen Regierungen von einer Dritten Welt.[24] Damit war der Begriff endgültig in den großen Weltsprachen etabliert, wenngleich er weiterhin, auch aufgrund seiner Übertragungen in verschiedene Sprachen und Kulturen, unterschiedlich verwendet wurde und unterschiedliche Bedeutungen transportierte.
3.2 Dritte-Welt-Semantiken im Ost-West-Konflikt
Der Ost-West-Konflikt brachte zwei dominante Deutungsmuster der Dritten Welt hervor. Für die Regierungen in Ost und West bezeichnete die Dritte Welt, nachdem sich die Fronten in Europa verfestigt hatten, zunehmend den Raum, in dem sie ihre Auseinandersetzungen austrugen. Bereits Anfang der 1950er-Jahre kam es in Korea zu ersten Konflikten zwischen den beiden Führungsmächten außerhalb Europas, ehe sich der Ost-West-Konflikt nach der Bandung-Konferenz und der Ungarn-Krise Mitte der 1950er-Jahre schwerpunktmäßig in die außereuropäische Welt verlagerte, wo er zu einem „Global Cold War” wurde. Die Regierungen in Moskau und Washington arbeiteten neue Strategien im Umgang mit den postkolonialen Ländern aus und erklärten die Dritte Welt zum entscheidenden Schauplatz und den Kampf um die Gunst der bündnisfreien Staaten zu einem wichtigen Ziel ihrer Auseinandersetzungen.[25]
Diese Wahrnehmung führte dazu, dass beide Supermächte durch die gezielte Vergabe von Entwicklungshilfe, durch die Ausbildung von Polizeikräften, durch die Unterstützung von oppositionellen Gruppierungen, durch Geheimdienstaktivitäten bis hin zu direkten militärischen Interventionen versuchten, Einfluss auf die Politik der Dritte Welt-Staaten zu nehmen.[26] Das diesen Aktivitäten zugrundeliegende Bild der Dritten Welt knüpfte direkt an Vorstellungen aus der Kolonialzeit an. Die Dritte Welt war in dieser Perspektive die Region, in der die (informellen) Regeln und Abkommen der Supermächte für die nördliche Halbkugel nicht galten. Sie war die Region, in der die Ausübung von direkter und indirekter Gewalt verbunden mit der Einmischung in staatliche Souveränitätsgebiete legitim war, in der sich andere Formen der zwischenstaatlichen Diplomatie etablierten und in der die ideologische Positionierung einer Regierung wichtiger als ihre demokratische respektive sozialistische Gesinnung war. Schließlich war die Dritte Welt aus dieser Perspektive die Region, in der die Supermächte ihren hegemonialen Führungsanspruch nicht vollständig durchsetzen konnten und die dortigen Regierungen auf ihre Distanz zu beiden Blöcken des Kalten Kriegs beharrten.
Letzteres Merkmal griff wiederum ein höchst heterogenes Akteursensemble europäischer Neutralisten auf, das nach Auswegen aus dem Ost-West-Konflikt suchte. Neben der Schweiz sahen sie in den bündnisfreien Staaten, die sich im Jahr 1961 erstmals in Belgrad versammelten, Vorbilder, die einen Weg aus dem Ost-West-Konflikt wiesen, indem sie sich der Parteinahme für eine Seite widersetzten und dadurch ihren außenpolitischen Handlungsspielraum vergrößerten. Als charakteristische Vertreter der bündnisfreien Dritten Welt galten Indien unter Jawaharlal Nehru, Ägypten unter Gamal Abdel Nasser und als europäischer Sonderfall Jugoslawien unter Josip Broz Tito. Besonders Jugoslawien schien den Neutralisten zu demonstrieren, dass eine entschlossene Regierung diesen „Dritten Weg” auch in Europa gehen könne. Diese aus dem Ost-West-Konflikt gespeiste Perspektive auf die Dritte Welt wurde während des „Zweiten Kalten Kriegs” und der deutschen Wiedervereinigung zum Teil erneut aktualisiert. In den 1960er-Jahren verlor sie mit der beginnenden Entspannungspolitik zwischen der Sowjetunion und den USA allerdings an Überzeugungskraft, während eine andere Interpretation der Dritten Welt an Einfluss gewann.[27]
3.3 Tiersmondisme der 1950er- und 60er-Jahre
Für viele Zeitgenossen der 1950er- und 60er-Jahre fungierte der Begriff der Dritten Welt als Sammelbezeichnung für die ehemaligen europäischen Kolonien. Dementsprechend prägten einerseits Diskurse und Bilder des Kolonialzeitalters diese Vorstellung einer Dritten Welt. Dritte Welt-Länder galten in den westlichen Staaten weiterhin als „unterentwickelt” und „überbevölkert”, und ihre Bevölkerung wurde weiterhin als „Farbige” bezeichnet.[28] Das Bild der Dritten Welt als Raum der Rückständigkeit und des enormen Bevölkerungswachstums hielt sich hartnäckig in der Öffentlichkeit und wurde regelmäßig aktualisiert. Die Entwicklungen in einigen dieser Länder schienen immer wieder dieses Bild für den gesamten Raum zu bestätigen.[29]
Andererseits stellte die Dekolonisierung die Vorstellung einer unterentwickelten und passiven Dritten Welt in Frage. Ausschlaggebend hierfür waren in den 1950er-Jahren die Konferenzen von Bandung und Belgrad, die Suez-Krise, die kubanische Revolution durch Fidel Castro und Che Guevara sowie der algerische Unabhängigkeitskampf, den einzelne Aktivisten aus Europa aktiv beispielsweise als „Kofferträger”[30] erlebten und unterstützten. Ebenso demonstrierten die Reden und Schriften von Intellektuellen und Politikern aus der Dritten Welt, dass die postkolonialen Staaten eigene Interessen verfolgten und Veränderungen in der internationalen Politik anstrebten.[31] Ihr Wunsch nach Veränderung prädestinierte sie wiederum dazu, zur Projektionsfläche der entstehenden europäischen Neuen Linken zu werden. Enttäuscht über die Politik des Parteimarxismus in den sozialistischen Ländern und das geringe revolutionäre Potenzial der westlichen Arbeiterbewegungen begannen sie sich in den 1950er- und 60er-Jahren auf die Suche nach einem neuen revolutionären Subjekt zu machen, um es schließlich in der Studentenschaft des Westens und vor allem der Dritten Welt zu entdecken.
Es setzten intensive theoretische Diskussionen zwischen Aktivisten aus der Dritten Welt und Europa über koloniale und imperiale Machtverhältnisse ein, „wobei das Erwachen einer im globalen Maßstab als Dritter Stand aufgefasster Dritten Welt alte Internationalismen und Utopien der ersten Jahrhunderthälfte absorbierte und sich mit marxistischen Ideologemen zur Vorstellung einer revolutionären Massenbewegung des Südens verband”.[32] Diese vor allem von Frantz Fanon und Jean-Paul Sartre in Frankreich,[33] in Deutschland von Hans Magnus Enzensberger und Rudi Dutschke[34] sowie durch zahlreiche Studierende aus Asien, Afrika und Lateinamerika vermittelte Vorstellung der Dritten Welt als weltrevolutionäres Subjekt hat sowohl maßgeblich zur Entstehung der Neuen Linken und transnationaler an der Dritten Welt interessierter Netzwerke beigetragen als auch die Wahrnehmungsachse eines „signifikanten Teils des linken bis linksliberalen politischen Spektrums vom Ost-West auf den Nord-Süd-Konflikt”[35] verschoben. Weitere Ereignisse und Entwicklungen Anfang der 1960er-Jahre wie die Verbreitung der Befreiungstheologie, Reformen und Politisierungstendenzen in der protestantischen und katholischen Kirche, die Ermordung von Patrice Lumumba im Kongo sowie eine Reihe von Filmskandalen (z.B. um „Africa Addio”) verstärkten das neue Interesse an der Dritten Welt.[36]
![Demonstrationsaufruf zur Internationalen Vietnam-Konferenz in Berlin am 18. Februar 1968, Quelle: Abubiju [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Internationale_Vietnam-Konferenz_1968.jpg?uselang=de Wikimedia Commons] ([http://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain?uselang=de gemeinfrei]).](sites/default/files/import_images/1485.jpg)
Ihre stärkste Strahlkraft erreichte diese Wahrnehmung der Dritten Welt in der Bundesrepublik mit dem Tod von Benno Ohnesorg im Sommer 1967 und den Protesten gegen den Vietnamkrieg im Jahr 1968.[37] Gleichzeitig veränderte sich in der Neuen Linken durch die Sympathiebekundungen mit Vietnam und China Ende der 1960er-Jahre noch einmal der Signifikant des Dritte Welt-Begriffs. Prägten Ende der 1950er-Jahre Indien, Ägypten und vor allem Algerien das Bild der Dritten Welt, so taten dies eine Dekade später hauptsächlich Kuba (Fidel Castro, Che Guevara), Vietnam (Ho Chi Minh) und China (Mao Zedong).[38] Dies führte unter anderem zu einem neuen, unpersönlicheren Verhältnis der westlichen Dritte Welt-Bewegung zur Dritten Welt. Denn während die frühe Dritte Welt-Solidarität noch auf persönliche Netzwerke zwischen Aktivisten aus Europa und der Dritten Welt aufbaute, ging diese persönliche Erfahrungsdimension in der Solidarisierung mit Vietnam und China zunehmend verloren, was wiederum die Aktionen der Aktivisten veränderte.[39]
Die Kritik am europäischen Kolonialismus wich der Kritik am amerikanischen Imperialismus, und die USA galten im linken Spektrum nicht mehr – wie noch nach dem Zweiten Weltkrieg – als „Verteidiger der Freiheit”, sondern als Bedrohung und neue imperialistische Macht, die ihre Interessen nicht nur in der Dritten Welt, sondern auch in Europa durchzusetzen versuchte. Aufgrund dieser Neubewertung der amerikanischen Politik konnten Aktivisten in Europa eine neue Verbindung (auch auf semantischer Ebene) jenseits der nicht mehr vorhandenen persönlichen Netzwerke herstellen, indem sie sich und die Dritte Welt als „Opfer” des amerikanischen Imperialismus verstanden. Mit diesem interdependenten Verständnis von Weltpolitik waren zum einen die ideellen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass jede Aktion vor Ort in Europa als revolutionäre Tätigkeit für die Befreiung der Dritten Welt verstanden werden konnte, wodurch sich jeder an jedem Ort, Guevaras Aufruf zur Schaffung vieler Vietnams entsprechend, für die Dritte Welt einsetzen konnte. Zum anderen verschob sich der Fokus vieler Aktivisten wieder von der Dritten Welt auf die eigene Gesellschaft und auf das eigene Handeln vor Ort.
Ende der 1960er-Jahre führte diese Entwicklung zur Radikalisierung der Neuen Linken, die aber nicht lange anhielt und schließlich zu deren Zerfall führte. Nur eine Minderheit ging zum Kampf gegen den von ihnen so bezeichneten amerikanischen Imperialismus über und versuchte, diesen, wie die RAF in Deutschland, in die Städte zu bringen. Die Mehrheit der Aktivisten trug diesen gewalttätigen politisierten Kurs nicht mit.[40] Sie fuhr ihr Engagement für die Dritte Welt entweder zurück, engagierte sich erneut für die europäischen Arbeiter oder wandte sich dem konkreten „pragmatischen” Handeln zu, das sie im Zeichen eines neuen Humanitarismus zugleich als „unpolitisches” respektive christliches Helfen verstand und wodurch ein alternatives Bild der Dritten Welt an Einfluss gewann.[41]
3.4 Dritte-Welt-Solidarität der 1970er-Jahre
Die Länder Asiens, Afrikas und Lateinamerikas galten schon während der Kolonialzeit als ökonomisch unterentwickelt. Nach deren politischer Unabhängigkeit wurde es für die westlichen Länder aber in gewisser Weise einfacher, auf diesen Zustand hinzuweisen, weil sie dafür nicht mehr direkt verantwortbar zu machen waren. Zudem verbreiteten sich nach dem Zweiten Weltkrieg makroökonomische Modelle, welche die Kategorien „unterentwickelt” und „entwickelt” wissenschaftlich absicherten und als objektive Beschreibungen der Welt erscheinen ließen. Mit beiden Kategorien wurden globale Ordnungen beschrieben, und mit ihrer weltweiten Verbreitung schufen sie neue Realitäten. Schließlich bezeichneten sogar die Regierungen der Dritten Welt ihre Staaten als Entwicklungsländer.[42]
![Eröffnung der ersten Aktion „Brot für die Welt” in Berlin am 12. Dezember 1959, Quelle: [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Er%C3%B6ffnung_Erste_Aktion.jpg?uselang=de Wikimedia Commons] ([https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de CC BY-SA 3.0]).](sites/default/files/import_images/1486.jpg)
Aus modernisierungstheoretischer Sicht bezeichnete die Dritte Welt sowohl den geografischen Raum, der durch Unterentwicklung und Rückständigkeit gekennzeichnet war, als auch den Ort, an dem Entwicklungshilfe nötig und sinnvoll war. Diese anscheinend wissenschaftlich-objektive Perspektive auf die Dritte Welt eröffnete seit den 1950er-Jahren eine Alternative zum politisierten Dritte Welt-Bild des Kalten Kriegs und des „Dritteweltismus”. Bereits im Jahr 1959 werden die kirchlichen Hilfswerke Brot für die Welt und Misereor gegründet, die das Bild einer verelenden Dritten Welt verbreiten. Sie erschien nun als ein Ort von Hungerkatastrophen und Flüchtlingskrisen, wo das Helfen per se als moralisch „gut” und unpolitisch galt. An Bedeutung gewann dieses Dritte Welt-Verständnis mit dem Bürgerkrieg in Nigeria, der damit einhergehenden Hungerkatastrophe in der Region Biafra und der Entstehung eines neuen Humanitarismus.[43]
Seit den 1950er-Jahren und verstärkt in Folge des Bürgerkriegs begannen sich Menschen in Europa und den USA für die „arme” Dritte Welt zu engagieren.[44] Relativ schnell bildeten diese Gruppierungen eigene Institutionen aus, womit eine Professionalisierung ihrer Tätigkeiten einherging, welche die Bereitschaft zu längerfristigem Engagement erkennen ließ und das damit verbundene Bild der Dritten Welt als ökonomisch unterentwickelt beziehungsweise hilfsbedürftig institutionell verankerte.[45] Im Jahr 1967 begann beispielsweise die niederländische Organisation S.O.S. Wereldhandel einen alternativen Handel mit der Dritten Welt. Drei Jahre später folgten in Deutschland die beiden kirchlichen Jugendverbände AEJ und BDJK, welche die Aktion Dritte-Welt-Handel ins Leben riefen. Im Jahr 1975 gründeten sich die Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit der Dritten Welt (GEPA) und die Arbeitsgemeinschaft Dritte Welt Läden. Bereits bestehende politische Gruppierungen, private Hilfswerke sowie Solidaritätskomitees steigerten ihre Aktivitäten, vergrößerten ihr Budget und gaben eigene Zeitschriften, Rundbriefe und Magazine heraus, die sich mit entwicklungspolitischen Themen, der Dritten Welt oder einzelnen Kontinenten respektive Ländern der Dritten Welt beschäftigten.[46] Katholische und evangelische Kirche(n) wandten sich verstärkt der Dritten Welt zu, und auch Politiker unterstützten die entstehende Dritte Welt-Bewegung.[47] Der reformfreudige Entwicklungsminister Erhard Eppler und Teile der Gründungsgrünen befürworteten eine selbstlosere Entwicklungshilfe und eine intensivere Beschäftigung mit den Problemen der Dritten Welt.[48] Ähnliche Bewegungen entstanden auch in der Schweiz, Schweden, Österreich und Frankreich, wobei sie von ihrem Interesse her grundsätzlich zur transnationalen Vernetzung neigten.[49]
Schließlich gewann das Thema mit einigen Jahren Verzögerung auch im wissenschaftlichen Bereich an Bedeutung. Zeitschriften und Jahrbücher wurden gegründet, die sich explizit mit der Dritten Welt beschäftigten.[50] Ende der 1970er- und Anfang der 1980er-Jahre erschienen zahlreiche wissenschaftliche Studien zur Dritten Welt, zu deren internationalen Institutionen, zur von den Dritte Welt-Ländern geforderten New International Economic Order sowie allgemeiner zum Nord-Süd-Dialog.[51] Die Dritte Welt war zu einem selbstverständlichen Bestandteil der Realität geworden, deren Existenz nicht in Frage gestellt wurde. Vielmehr nahmen die Zeitgenossen die vielfältigen Interaktionen zwischen dieser und den beiden anderen Welten immer stärker wahr. Gleichzeitig nahm seit den 1970er-Jahren das globale Interdependenzbewusstsein zu, weshalb immer mehr Aktivisten von „Einer” statt von „Drei” Welten sprachen.[52]
3.5 Dritte-Welt-Semantiken in den 1980er-Jahren
In den 1980er-Jahren wurden die bereits etablierten drei Deutungen der Dritten Welt einerseits aktualisiert und neu konfiguriert. In der Tradition des Tiermondisme stehende Aktivisten sahen in der Dritten Welt weiterhin ein Subjekt mit revolutionärem Potenzial, wobei sich die konkreten Personen und Länder, auf die sie ihre Hoffnungen projizierten erneut wandelten. Das Interesse an China und Vietnam ließ nach, während sich zunehmend mehr Dritte-Welt-Komitees mit Lateinamerika beschäftigten. Ins Zentrum ihrer Aufmerksamkeit rückten Chile, Argentinien und schließlich Nicaragua. Des Weiteren gewannen für diese Strömung das Engagement für Befreiungsbewegungen im südlichen Afrika sowie der Kampf gegen die Apartheid an Bedeutung. Boykottaufrufe respektive Boykottmaßnahmen gegen die südafrikanische Regierung stellten dabei Aktionen dar, die auch von jenen Dritte-Welt-Aktivisten mitgetragen werden konnten, die in den wirtschaftlichen Problemen und der hohen Verschuldung das Hauptmerkmal der Dritten Welt sahen und sich für die ökonomische Entwicklung dieser Länder engagierten.[53]
Neben der konkreten Ländersolidarität setzte sich die entwicklungspolitisch motivierte Dritte-Welt-Bewegung u.a. für die Fortsetzung des Nord-Süd-Dialogs und für ein stärkeres Engagement der Industrieländer im Bereich der Entwicklungshilfe und für fairen Handel ein, während sie die Strukturanpassungsprogramme des IWF und der Weltbank kritisierte.[54] Die Aktionen der Dritte-Welt-Komitees waren damit anschlussfähig für Kapitalismuskritiker und Globalisierungsgegner sowie für Friedensaktivisten, die mit Beginn des „Zweiten Kalten Kriegs” Anfang der 1980er-Jahre in der bündnisfreien Außenpolitik zahlreicher Dritte-Welt-Länder erneut einen Ausweg aus der Blockkonfrontation sahen. Kampagnen, welche die Industrieländer aufforderten, in Entwicklungsmaßnahmen anstatt in Waffen zu investieren, lag dabei ein Bild der Dritten Welt zugrunde, das verschiedene Dritte-Welt-Vorstellungen miteinander verknüpfte.
Andererseits führten die umfangreichen zivilgesellschaftlichen, politischen und wissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit der Dritten Welt dazu, dass die Divergenzen zwischen den einzelnen Dritte-Welt-Ländern, aber auch die Unterschiede zwischen auf die Dritte Welt projizierten Erwartungen und real gemachten Erfahrungen immer deutlicher hervortraten. Die Dritte Welt verlor in den 1970er- und 80er-Jahren für viele Aktivisten ihr revolutionäres Potenzial. Die postkolonialen Staatsoberhäupter erschienen ihnen zunehmend selbst als korrupte, machtbesessene Diktatoren (z.B. Ibi Amin, Pol Pot), die vor Gewalt und Unterdrückung gegenüber der eigenen Bevölkerung nicht zurückschreckten und eher Hindernisse auf dem Weg zu einer „besseren” Welt darstellten.[55] Menschenrechtsverletzungen wurden zu einem Signum der Dritten Welt.[56]
Zugleich betonten Wirtschafts-, Politik- und Sozialwissenschaftler anhand ihrer gesammelten Daten immer häufiger die politischen und ökonomischen Unterschiede zwischen den Ländern der Dritten Welt, anstatt wie früher deren Gemeinsamkeiten hervorzuheben.[57] Auch angesichts des wirtschaftlichen Aufschwungs der asiatischen Tigerstaaten und den Hungerkrisen in afrikanischen Ländern nahmen sie eine konzeptuelle Binnendifferenzierung der Dritten Welt vor und begannen, in Abgrenzung von der Dritten Welt respektive den Entwicklungsländern, von einer „Vierten Welt” oder den „Least Developed Countries” zu sprechen. Postkoloniale, postmoderne und poststrukturalistische Theorien sowie das Aufkommen der Area-Studies verstärkten den Trend zur Ausdifferenzierung der Dritten Welt. Sie stellten die Kategorie des Nationalstaats und die Einheit des postkolonialen Staats in Frage und lehnten eine nationalstaatliche Einteilung der Welt ab.[58]
Zusammengenommen erschwerten diese Entwicklungen eine räumliche Verortung der Dritten Welt, die in ihren Analysen höchstens noch als örtlich nicht gebundene Zustandsbeschreibung Verwendung fand, ansonsten aber als Beschreibungs- und Ordnungskategorie der Welt in Kritik geriet. Ende der 1970er-Jahre verschoben sich Erfahrungsraum und Erwartungshorizont im Hinblick auf die Dritte Welt, was eine Welle grundlegender Kritik am Dritte-Welt-Begriff auslöste, die mit dem Ende des Ost-West-Konflikts noch an Vehemenz gewann.[59]
3.6 Ende der Dritten Welt? – Von den „Drei Welten” zur „Einen Welt”
Nach der Auflösung der Sowjetunion und dem damit verbundenen Wegfall des sowjetischen Feindbilds avancierte die Dritte Welt zur zentralen Bedrohung für die westlichen Industrieländer. Die Dritte Welt bezeichnete Anfang der 1990er-Jahre ein breites Spektrum diffuser Bedrohungen, mit denen sich der Westen konfrontiert sah und deren Herkunft er in der Dritten Welt verortete. Der Begriff diente in der westlichen Öffentlichkeit vor allem als Bezeichnung eines Zustands, genauer als Chiffre für Überbevölkerung, Armut, Hunger, Krankheit (insbesondere Aids), Flüchtlinge und Migration, ökologische Katastrophen, Korruption, Kriminalität, Gewalt und Terror.[60] Die Dritte Welt stellte anders als noch die Sowjetunion eine „Chaosmacht” dar, die sich nicht klar benennen und definieren ließ und die nicht konstruktiv agierte, die aber durch ihr Destruktionspotenzial die Sicherheit und den Wohlstand der westlichen Länder gefährden konnte.[61] Der Begriff Dritte Welt bezeichnete wieder häufiger einen Zustand, der sich geografisch nicht mehr nur auf der südlichen, sondern auch auf der nördlichen Halbkugel finden ließ.[62]
Jenseits dieses Sprachgebrauchs ging die Verwendung des Begriffs seit den 1990er-Jahren zurück. Mit der Verbreitung des Eine-Welt-Diskurses, dem Zerfall der Sowjetunion und der Auflösung des Ostblocks verlor das Drei-Welten-Modell weiter an Überzeugungskraft.[63] Nach und nach nannten sich die westlichen „Dritte-Welt-Läden” in „Eine-Welt-Läden” um. Die geopolitischen Veränderungen der Jahre 1989/1991 führten dazu, dass die bündnisfreie Dritte Welt ihre Bedeutung, die sie aus ihrer „dritten Position” im Systemkonflikt zwischen Ost und West erlangt hatte, mit dem Ende des Kalten Kriegs schlagartig verlor. Die Aufmerksamkeit des Westens richtete sich in den 1990er-Jahren auf die ehemals Zweite Welt und die dort stattfindenden Umbrüche, während das Interesse an der Dritten Welt und deren Institutionen bis in die Gegenwart stark nachließ.[64]
Darüber hinaus verkündeten zahlreiche Wissenschaftler das Ende der Dritten Welt sowohl als empirisch fassbare Einheit als auch als sinnvolle Kategorie zur Beschreibung derselben.[65] Am Ende seines Lebens widerrief sogar Alfred Sauvy in einem Beitrag für die Zeitung „Le Monde” vom 14. Februar 1989 die von ihm geprägte Bezeichnung „Dritte Welt”. Es führe seiner Ansicht nach zu weit, die Länder Schwarzafrikas und die „Tigerstaaten” unter einem Begriff zu subsummieren.[66] Schließlich führte die negative Konnotation des Dritte-Welt-Begriffs dazu, dass dessen Verwendungsweise als geografische Bezeichnung respektive als Selbst- und Fremdbeschreibung zunehmend zurückging und als politisch unkorrekt galt. Im journalistischen, wissenschaftlichen und politischen Sprachgebrauch wurde der Begriff entweder in Anführungszeichen und mit Erläuterungen verwendet oder durch andere Begriffe wie beispielsweise „new emerging markets” oder „globaler Süden” ersetzt.
4. Geschichtswissenschaft und Dritte Welt
Seit den 1960er-Jahren ist eine kaum mehr zu überschauende Zahl an Studien zur Dritten Welt erschienen. Diese überwiegend von Politologen, Sozialwissenschaftlern, Geografen, Ethnografen und Ökonomen verfassten Studien gingen zunächst von der Annahme aus, dass es die Dritte Welt als beschreibbare und untersuchbare Entität gäbe.[67] Bereits in den 1970er-und 80er-Jahren revidierten sie diese Hypothese allerdings. Immer deutlicher wurde, dass die älteren Ansätze sich nicht mit den empirischen Untersuchungsergebnissen und neueren theoretischen Annahmen vereinbaren ließen, wodurch die Dritte Welt als Konstrukt erschien, das von bestimmten Gruppierungen in bestimmten Kontexten erzeugt wurde.[68] Ein seit den 1970er-Jahren zunehmendes globales Interdependenzbewusstsein, das Ende des Ost-West-Konflikts und die Desintegration der sozialistischen Zweiten Welt stellten die Vorstellung einer Dritten Welt dann endgültig in Frage. Immer mehr Studien diagnostizierten das Ende der Dritten Welt.[69] Diese doppelte epistemische und realpolitische Herausforderung des Dritte-Welt-Konzepts durch neue Theorien und die politischen Ereignisse von 1989/1991 führten schließlich zu einer Neufokussierung der Wissenschaft auf Osteuropa und zu einem deutlichen Rückgang des wissenschaftlichen Interesses an der Dritten Welt.
Erst das neue Interesse an transnationalen, transfer- und globalgeschichtlichen Perspektiven auf die Vergangenheit veränderte dies. Seit einigen Jahren häufen sich die Vorstöße, die Geschichte und Semantiken der Dritten Welt in die (Teil-)Geschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu integrieren. So hat die explizite Berücksichtigung der Dritten Welt maßgeblich zu einer Neuinterpretation des Ost-West-Konflikts als „Global Cold War” beigetragen.[70] Auf ähnliche Weise hat der Einbezug von Aktivisten aus der Dritten Welt und die stärkere Beachtung von Austauschbeziehungen zwischen diesen und der bundesdeutschen Studentenbewegung respektive der französischen Neuen Linken dazu beigetragen, deren Entstehung nicht ausschließlich aus der Nationalgeschichte beider Länder heraus zu erklären, sondern auch als Produkt transnationaler Verflechtungen.[71] Schließlich haben Studien zur Dekolonisierung, zu Organisationen postkolonialer Länder sowie zu denen westlicher Länder herausgearbeitet, dass der für die 1970er-Jahre festgestellte Globalisierungsschub zu einem großen Teil aus den Wechselwirkungen zwischen Entwicklungen in der südlichen und nördlichen Halbkugel sowie einem zunehmenden globalen Interdependenzbewusstsein resultierte.[72]
Diese Einzelstudien haben unser Wissen über die Dritte Welt enorm erweitert, gleichwohl ergeben sich vor dem Hintergrund des jetzigen Forschungsstands mindestens zwei größere Bereiche für weitere Studien. Erstens erscheint es notwendig, nachdem das Pendel von der Annahme einer realgeschichtlichen Existenz der Dritten Welt in den 1980er- und 90er-Jahren umgeschwungen ist zu der Praxis, diese als Konstruktion gesellschaftlicher Gruppierungen zu untersuchen, in Anlehnung an die Ergebnisse neuer Studien für einen Mittelweg zwischen beiden Extremen zu plädieren. So lange, wie im Hinblick auf die Dritte Welt deren Konstruktionscharakter reflektiert wird, gilt es, sich weiterhin mit der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Geschichte der Länder Asiens, Afrikas und Lateinamerikas auseinanderzusetzen. Denn nimmt man die Geschichte der postkolonialen Staaten ernst und fragt nach den Unterschieden sowie gemeinsamen Erfahrungen und Entwicklungen dieser Länder, eröffnen sich neue Einsichten nicht nur im Hinblick auf deren eigene Geschichte, sondern auch insgesamt auf die Geschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In der Globalgeschichte des Zweiten Weltkriegs fehlt beispielsweise, abgesehen von ersten anregenden Vorarbeiten, immer noch die Perspektive der Dritten Welt.[73]
Auch lohnt es sich, weiter nach den besonderen Bedingungen und Verläufen der Staatsbildungsprozesse in Asien und Afrika im Kontext von Dekolonisierung, Ost-West-Konflikt und nation-building zu fragen. Durch deren Analyse ließe sich nicht nur die Geschichte des modernen Staats um eine spezifische Ausformung ergänzen. Auch in diachroner Perspektive könnte die Analyse postkolonialer Staatsbildungen einen neuen verfremdeten Blick auf Staatsbildungsprozesse im Europa des 19. Jahrhunderts ermöglichen und einer Exotisierung der postkolonialen Welt entgegenwirken.[74] Des Weiteren laden die verschiedenen regionalen und überregionalen Organisationsversuche der Länder Asiens, Afrikas und Lateinamerikas geradezu zu einem Vergleich mit dem europäischen Integrationsprozess ein. Dadurch ließen sich nicht nur die Gemeinsamkeiten und Besonderheiten beider Entwicklungen stärker akzentuieren, sondern auch deren gegenseitige Beeinflussung und Wahrnehmung.[75] Dies würde schließlich auch die Auseinandersetzungen zwischen den Staaten der südlichen und der nördlichen Halbkugel um Regeln und Abkommen der internationalen Ordnung, welche die internationale Geschichte des 20. Jahrhunderts tiefgreifend prägten, wieder stärker in das Blickfeld von Historikern rücken.[76]
Zweitens gilt es weiter nach den verschiedenen Vorstellungen von einer Dritten Welt, nach deren Entstehung und Wirkmächtigkeit zu fragen, um zu analysieren, wie Menschen den Wandel der globalen Ordnung nach 1945 fassten. Im Zentrum des Erkenntnisinteresses standen bisher die Sichtweisen der Studentenbewegung, der Neuen Linken und von Ökonomen.[77] Demgegenüber sind Perspektiven Anderer auf die Dritte Welt noch relativ wenig erforscht. Dies gilt zum einen ganz allgemein für alle Länder und Gruppierungen des ehemals kommunistischen Ostens. Abgesehen von wenigen Ausnahmen sind die Interaktionen und Perspektiven der Sowjetunion und ihrer Verbündeten mit respektive auf die Dritte Welt noch kaum untersucht.[78] Zum anderen ist auch über westliche Sichtweisen, jenseits der Studentenbewegung und der Neuen Linken, noch wenig über die breite gesellschaftliche Rezeption der Dritten Welt bekannt. Erste vielversprechende Studien zum Dritte-Welt-Bild christlicher Gruppierungen, schwedischer Unternehmen und von Geschäftsleuten sowie zu westlichen Reise-/Tourismuserfahrungen deuten ein facettenreiches Bild an.[79] Schließlich liegen speziell für den Rückgang des Dritte-Welt-Interesses seit Ende der 1980er-Jahre und das Aufkommen neuer Beschreibungen der Dritten Welt respektive der Welt als „globaler Süden” bzw. als „Eine-Welt” ebenso wenig Studien vor wie zu den Fragen, welche Akteure mit welcher Intention und mit welcher Konnotation den Begriff nicht mehr verwendeten und welche alternativen Begriffe und Kategorien sie stattdessen benutzten. Gerade das Verschwinden des Dritte-Welt-Begriffs deutet ein verändertes globales Bewusstsein an, dessen Entstehung erst in Ansätzen untersucht ist.[80] Gleichzeitig schafft dieser Wandel Distanz, um mit der Historisierung der Geschichte und den Semantiken der Dritten Welt zu beginnen.
Anmerkungen
- ↑ Der Autor dankt Florian Hannig, David Kuchenbuch und der Docupedia-Redaktion sowie dem Gutachter für ihre konstruktiven Anmerkungen. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden darauf verzichtet, den Begriff der „Dritten Welt“ ebenso wie vergleichbare Begriffe wie den „Westen“, den „Osten“ oder den „globalen Süden“ nach ihrer erstmaligen Nennung in Anführungszeichen zu setzen.
- ↑ Vgl. Christoph Kalter, „Le monde va de l’avant. Et vous êtes en marge“. Dekolonisierung, Dezentrierung des Westens und Entdeckung der „Dritten Welt“ in der radikalen Linken in Frankreich in den 1960er-Jahren, in: Archiv für Sozialgeschichte 48 (2008), S. 99-132, hier S. 101ff; Jan Eckel, Die Ambivalenz des Guten. Menschenrechte in der internationalen Politik seit den 1940ern, Göttingen 2014, S. 768f; Carl E Pletsch, The Three Worlds, or the Division of Social Scientific Labor, circa 1950-1975, in: Comparative Studies in Society and History 23 (1981), H. 4, S. 565-590.
- ↑ Vgl. Jan C. Jansen/Jürgen Osterhammel, Dekolonisation. Das Ende der Imperien, München 2013.
- ↑ Vgl. Bernd Greiner, Kalter Krieg und "Cold War Studies", Version: 1.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 11.2.2010, http://docupedia.de/zg/Cold_War_Studies?oldid=84591.
- ↑ Vgl. Daniel Speich Chassé, Fortschritt und Entwicklung, Version: 1.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 21.9.2012, http://docupedia.de/zg/Fortschritt_und_Entwicklung?oldid=84606; Hubertus Büschel, Geschichte der Entwicklungspolitik, Version: 1.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 11.2.2010, http://docupedia.de/zg/Geschichte_der_Entwicklungspolitik?oldid=84614.
- ↑ Vgl. Jansen/Osterhammel, Dekolonisation; Dietmar Rothermund, Delhi, 15. August 1947. Das Ende kolonialer Herrschaft, München 1998; Raymond F. Betts, Decolonization, New York 2004.
- ↑ Vgl. Jansen/Osterhammel, Dekolonisation, S. 97.
- ↑ Vgl. Jürgen Dinkel, Bündnisfreiheit und die Bewegung Bündnisfreier Staaten. ihrer Genese, Organisation, Politik (1927-1992), München 2015 (i.E.); Nataša Mišković/Harald Fischer-Tiné/Nada Boškovska (Hrsg.), The Non-Aligned Movement and the Cold War. Delhi – Bandung – Belgrade, Routledge 2014; Svetozar Rajak, Yugoslavia and the Soviet Union in the Early Cold War. Reconciliation, Comradeship, Confrontation, 1953-1957, London 2011; Kristin S Tassin, „Lift up your Head, my Brother“: Nationalism and the Genesis of the Non-Aligned Movement, in: Journal of Third World Studies 23 (2006), S. 147-168.
- ↑ Vgl. Jürgen Osterhammel, Kolonialismus. Geschichte, Formen, Folgen, München 2009, S. 121.
- ↑ Vgl. Jansen/ Osterhammel, Dekolonisation; Vijay Prashad, The Darker Nations. A People's History of the Third World, New York 2007; Dinkel, Bündnisfreiheit.
- ↑ Vgl. Benedikt Stuchtey, Die europäische Expansion und ihre Feinde. Kolonialismuskritik vom 18. bis in das 20. Jahrhundert, München 2010; Robert J. C. Young, Postcolonialism. An Historical Introduction, Oxford/Malden 2009; Jürgen Dinkel, Globalisierung des Widerstands: Antikoloniale Konferenzen und die ”Liga gegen Imperialismus und für nationale Unabhängigkeit" 1927-1937, in: Sönke Kunkel/Christoph Meyer (Hrsg.), Aufbruch ins postkoloniale Zeitalter. Globalisierung und die außereuropäische Welt in den 1920er und 1930er Jahren, Frankfurt a.M. 2012, S. 209-230; Pankaj Mishra, Aus den Ruinen des Empires. Die Revolte gegen den Westen und der Wiederaufstieg Asiens, Frankfurt a.M. 2013.
- ↑ Vgl. Odd Arne Westad, The Global Cold War. Third World Interventions and the Making of Our Times, Cambridge 2008; Andreas Hilger (Hrsg.), Die Sowjetunion und die Dritte Welt. UdSSR, Staatssozialismus und Antikolonialismus im Kalten Krieg, 1945-1991, München 2009; Robert B. Rakove, Kennedy, Johnson, and the Nonaligned World, Cambridge 2013; Robert J. McMahon (Hrsg.), The Cold War in the Third World, Oxford 2013.
- ↑ Vgl. Slobodan Vujović (Hrsg.), The Conference of Heads of State or Government of Non-Aligned Countries. Belgrade, September 1-6. 1961, Beograd 1961.
- ↑ Vgl. Sönke Kunkel, Zwischen Globalisierung, internationalen Organisationen und "global governance". Eine kurze Geschichte des Nord-Süd-Konflikts in den 1960er und 1970er Jahren, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte (2012), H. 4, S. 555-577.
- ↑ Vgl. General Secretariat of the O.S.P.A.A.A.L. (Hrsg.), First Solidarity Conference of the Peoples of Africa, Asia and Latin America, Havanna 1966; Christoph Kalter, Die Entdeckung der Dritten Welt. Dekolonisierung und neue radikale Linke in Frankreich, Frankfurt/New York 2011, S. 305-311.
- ↑ Vgl. Robert A. Mortimer, The Third World Coalition in International Politics, Boulder/London 1984; Jürgen Dinkel, Dekolonisierung und Weltnachrichtenordnung. Der Nachrichtenpool bündnisfreier Staaten (1976-1992), in: Frank Bösch/Peter Hoeres (Hrsg.), Außenpolitik im Medienzeitalter. Vom späten 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Göttingen 2013, S. 211-231.
- ↑ Vgl. Chen Jian, China, the Third World, and the Cold War, in: Robert J. McMahon (Hrsg.), The Cold War in the Third World, Oxford 2013, S. 85-100.
- ↑ Vgl. Jacqueline Anne Braveboy-Wagner, Institutions of the Global South, New York 2009; Chris Alden/Sally Morphet/Marco Antonia Vieira, The South in World Politics, New York 2010.
- ↑ Zur Entstehungsgeschichte vgl. den aufschlußreichen und detaillierten Überblick von Christoph Kalter. Kalter, Entdeckung, S. 53-57.
- ↑ Erneut abgedruckt in Alfred Sauvy, Trois mondes, une planète, in: Serge Cordellier/Fabienne Doutaut (Hrsg.), La fin du Tiers monde?, Paris 1996, S. 145-147.
- ↑ Vgl. Sauvy, Mondes, S. 146. Zitiert nach Kalter, Entdeckung, S. 54.
- ↑ Vgl. Erik Tängerstad, „The Third World“ as an Element in the Collective Construction of a Post-Colonial European Identity, in: Bo Stråth (Hrsg.), Europe and the Other and Europe as the Other, Frankfurt a.M. 2000, S. 157-193.
- ↑ Vgl. Ragna Boden, Die Grenzen der Weltmacht. Sowjetische Indonesienpolitik von Stalin bis Brežnev, Stuttgart 2006, S. 100.
- ↑ Vgl. Third World Attitude Hardens at Algiers, in: The Times, 11.9.1973.
- ↑ Vgl. Westad, Global Cold War; Rakove, Kennedy.
- ↑ Vgl. Marc Frey, Die Vereinigten Staaten und die Dritte Welt im Kalten Krieg, in: Bernd Greiner/Christian Th. Müller/Dierk Walter (Hrsg.), Heiße Kriege im Kalten Krieg, Hamburg 2006, S. 35-60; Marc Frey, Dekolonisierung in Südostasien. Die Vereinigten Staaten und die Auflösung der europäischen Kolonialreiche, München 2006.
- ↑ Vgl. Alexander Gallus, Die Neutralisten. Verfechter eines vereinten Deutschlands zwischen Ost und West 1945-1990, Düsseldorf 2001; Dominik Geppert/Udo Wengst (Hrsg.), Neutralität – Chance oder Chimäre? Konzepte des Dritten Weges für Deutschland und die Welt 1945-1990, München 2005.
- ↑ Vgl. John Paul Drexler, Die Front der Farbigen, München 1957; Piero Gheddo, Die farbigen Völker erwachen, Frankfurt a.M. 1958.
- ↑ Vgl. Thomas Etzemüller, Ein ewigwährender Untergang. Der apokalyptische Bevölkerungsdiskurs im 20. Jahrhundert, Bielefeld 2007; Marc Frey, Experten, Stiftungen und Politik: Zur Genese des globalen Diskurses über Bevölkerungen seit 1945, in: Zeithistorische Forschungen 4 (2007), H. 1+2.
- ↑ Vgl. Claus Leggewie, Kofferträger. Das Algerien-Projekt der Linken im Adenauer-Deutschland, Berlin 1984.
- ↑ Vgl. Bassam Tibi, Politische Ideen in der "Dritten Welt" während der Dekolonisation, in: Iring Fetscher/Herfried Münkler (Hrsg.), Pipers Handbuch der politischen Ideen, Bd. 5, Neuzeit. Vom Zeitalter des Imperialismus bis zu den neuen sozialen Bewegungen, München 1987, S. 361-402; Hermann Halbeisen, Sunismus und Maoismus, in: Fetscher/Münkler (Hrsg.), Handbuch, S. 403-419.
- ↑ Vgl. Wilfried Mausbach, Von der "zweiten Front" in die friedliche Etappe? Internationale Solidaritätsbewegungen in der Bundesrepublik 1968-1983, in: Sven Reichardt/Detlef Siegfried (Hrsg.), Das alternative Milieu. Antibürgerlicher Lebensstil und linke Politik in der Bundesrepublik Deutschland und Europa; 1968-1983, Göttingen 2010, S. 423-444, hier S. 427.
- ↑ Vgl. Frantz Fanon, Les Damnés de la Terre. Préface de Jean-Paul Sartre, Paris 1961.
- ↑ Zu Dutschkes Tätigkeiten vgl. Quinn Slobodian, Foreign Front. Third World Politics in Sixties West Germany, Durham, NC 2012, S. 51-61. Zu Enzensberger vgl. beispielsweise das zweite Heft des von ihm herausgegebenen „Kursbuchs“ (August 1965) mit Texten u.a. von Frantz Fanon (S. 1-55) und Fidel Castro (S. 73-82) sowie Enzensbergers eigenen Ausführungen zur „Europäischen Peripherie“ (S. 154-173).
- ↑ Mausbach, Front, S. 426. Vgl. Slobodian, Front; Dorothee Weitbrecht, Aufbruch in die Dritt Welt. Der Internationalismus der Studentenbewegung von 1968 in der Bundesrepublik Deutschland, Göttingen 2012; Samantha Christiansen/Zachary A. Scarlett (Hg.), The Third World in the Global 1960s, New York 2013; Julie Hessler, Death of an African Student in Moscow. Race, Politics, and the Cold War, in: Cahiers du Monde russe 47 (2006), S. 33-64; Thomas Etzemüller, 1968 – ein Riss in der Geschichte? Gesellschaftlicher Umbruch und 68er-Bewegungen in Westdeutschland und Schweden, Konstanz 2005.
- ↑ Vgl. Slobodian, Front.
- ↑ Vgl. Slobodian, Front, S. 77; Martin Klimke, The Other Alliance. Student Protest in West Germany and the United States in the Global Sixties, Princeton, NJ 2010.
- ↑ Vgl. Thomas Neuner, Paris, Havanna und die intellektuelle Linke. Kooperationen und Konflikte in den 1960er Jahren, Konstanz 2012.
- ↑ Vgl. Slobodian, Front, S. 169.
- ↑ Vgl. Klimke, Alliance.
- ↑ Einen Überblick über die Geschichte des Humanitarismus im 20. Jahrhundert bieten: Johannes Paulmann, Conjunctures in the History of International Humanitarian Aid During the Twentieth Century, in: Humanity: An International Journal of Human Rights, Humanitarianism and Development 4 (2013), H. 2, S. 215-238; Michael N. Barnett, Empire of Humanity. A History of Humanitarianism, Ithaca, N.Y. 2011; Daniel Maul/Dietmar Süß (Hrsg.), Humanitarianism in Times of War, 1850-2010, (i.E.) 2015.
- ↑ Vgl. Daniel Speich Chassé, Die Erfindung des Bruttosozialprodukts. Globale Ungleichheit in der Wissensgeschichte der Ökonomie, Göttingen 2013; Hildegard Brog, Handel statt Hilfe. Die entwicklungspolitischen Vorstellungen in der Havanna-Charta 1947/48, Frankfurt a.M. 1990; Walther L. Bernecker, Port Harcourt, 10. November 1995. Aufbruch und Elend in der Dritten Welt, München 1997.
- ↑ Vgl. Florian Hannig, Biafra und die Globalisierung humanitärer Hilfe – eine westdeutsche Perspektive, erscheint in: Maul/Süß (Hrsg.), Humanitarianism.
- ↑ Vgl. Mausbach, Front; Weitbrecht, Aufbruch; Sebastian Tripp, Die Weltkirche vor Ort. Die Globalisierung der Kirchen und die Entstehung christlicher "Dritte-Welt"-Gruppen, in: Wilhelm Damberg (Hrsg.), Soziale Strukturen und Semantiken des Religiösen im Wandel. Transformationen in der Bundesrepublik Deutschland 1949-1989, Essen 2011, S. 123-136.
- ↑ Vgl. Florian Hannig, The Biafra-Crisis and the Establishment of Humanitarian Aid in West Germany as New Philanthropic Field, in: Arnd Bauerkämper/Gregory Witkowski (Hrsg.), German Philanthropy in Transatlantic Perspective, Indiana (i.E.) 2015.
- ↑ Vgl. Claudia Olejniczak, Die Dritte-Welt-Bewegung in Deutschland. Konzeptionelle und organisatorische Strukturmerkmale einer neuen sozialen Bewegung, Wiesbaden 1999, S. 122-136.
- ↑ Vgl. Katharina Kunter/Annegreth Schilling (Hrsg.), Globalisierung der Kirchen. Der Ökumenische Rat der Kirchen und die Entdeckung der Dritten Welt in den 1960er und 1970er Jahren, Göttingen 2014. Stefan Nacke, Die Kirche der Weltgesellschaft. Das II. Vatikanische Konzil und die Globalisierung des Katholizismus, Wiesbaden 2010.
- ↑ Vgl. Bastian Hein, Die Westdeutschen und die Dritte Welt. Entwicklungspolitik und Entwicklungsdienste zwischen Reform und Revolte 1959 - 1974, München 2006; Silke Mende, "Nicht rechts, nicht links, sondern vorn". Eine Geschichte der Gründungsgrünen, München 2011.
- ↑ Vgl. René Holenstein, Was kümmert uns die Dritte Welt. Zur Geschichte der internationalen Solidarität in der Schweiz, Zürich 1998; Monica Kalt, Tiersmondismus in der Schweiz der 1960er und 1970er Jahre. Von der Barmherzigkeit zur Solidarität, Bern 2010; Konrad J. Kuhn, Entwicklungspolitische Solidarität. Die Dritte-Welt-Bewegung in der Schweiz zwischen Kritik und Politik (1975-1992), Zürich 2011.
- ↑ Vgl. z.B. Third World Quarterly (1979); Peripherie. Zeitschrift für Politik und Ökonomie in der Dritten Welt (1980), Jahrbuch Dritte Welt (1983); Blätter des iz3w; Dieter Nohlen (Hrsg.), Lexikon Dritte Welt, Baden-Baden 1980.
- ↑ Vgl. Sean MacBride, Many Voices, One World. Communication and Society Today and Tomorrow ; towards a new more just and more efficient world information and communication order; [report by the International Commission for the Study of Communication Problems], London 1980; Independent Commission on International Development Issues (Hrsg.), North-South: A Programme for Survival. Report of the Independent Commission on International Development Issues, London 1980.
- ↑ Vgl. David Kuchenbuch, "Eine Welt". Globales Interdependenzbewusstsein und die Moralisierung des Alltags in den 1970er und 1980er Jahren, in: Geschichte und Gesellschaft 38 (2012), S. 158-184.
- ↑ Vgl. Olejniczak, Dritte-Welt-Bewegung, S. 151.
- ↑ Vgl. Kuhn, Solidarität, S. 152.
- ↑ Für ein frühes Beispiel dieser Kritik vgl. Kursbuch, Der Mythos des Internationalismus, H. 57, Oktober 1979.
- ↑ Vgl. Eckel, Ambivalenz, S. 770-778.
- ↑ Vgl. Dieter Nohlen/Franz Nuscheler (Hrsg.), Handbuch der Dritten Welt, Bd. 1-4, Hamburg 1974f.; Ulrich Menzel/Dieter Senghaas, Europas Entwicklung und die Dritte Welt. Eine Bestandsaufnahme, Frankfurt a.M. 1986; Peter Worsley, How Many Worlds?, in: Third World Quarterly 1 (1979), H. 2, S. 100-108; weitere Hinweise auf zeitgenössische Literatur finden sich bei Kalter, Entdeckung, S. 65-72.
- ↑ Vgl. Arif Dirlik, Spectres of the Third World: Global Modernity and the End of the three Worlds, in: Third World Quarterly 25 (2004), H. 1, S. 131-148.
- ↑ Vgl. Werner Balsen/Karl Rössel, Hoch die internationale Solidarität. Zur Geschichte der Dritte Welt-Bewegung in der Bundesrepublik, Köln 1986; Pascal Bruckner, Das Schluchzen des weißen Mannes: Europa und die Dritte Welt, eine Polemik, Berlin 1984.
- ↑ Vgl. Volker Matthies, "Feindbild" Dritte Welt? Wider die Militarisierung und Marginalisierung der Nord-Süd-Beziehungen, in: ders. (Hrsg.), Kreuzzug oder Dialog. Die Zukunft der Nord-Süd-Beziehungen, Bonn 1992, S. 7-22.
- ↑ Vgl. Reymer Klüver, Zerbrochene Welt. Je näher uns die Probleme des Südens rücken, umso weiter schieben wir sie von uns fort, in: Süddeutsche Zeitung, 6.3.1993; David D. Newsom, New Directions for the Third World, in: The Christian Science Monitor, 24.5.1990.
- ↑ Vgl. David Rieff, Los Angeles. Capital of the Third World, New York 1991. Rieffs Buch schließt damit an ältere Darstellungen aus dem Kolonialzeitalter an, die ebenfalls Zustände aus den Kolonien in den westlichen Metropolen beobachteten. Als berühmtes Beispiel hierfür vgl. Upton Sinclair, The Jungle, London 1906.
- ↑ Vgl. Kuchenbuch, Welt.
- ↑ Vgl. Sally Morphet, Multilateralism and the Non-Aligned Movement: What Is the Global South Doing and Where Is It Going?, in: Global Governance 10 (2004), S. 517-537, online unter http://www.artsrn.ualberta.ca/courses/PoliticalScience/357B1/documents/MorphetMultilateralismNAMWhatIsGlobalSouthDoing.pdf.
- ↑ Vgl. Nigel Harris, The End of the Third World. Newly Industrializing Countries and the Decline of an Ideology, London 1986; Ulrich Menzel, Das Ende der Dritten Welt und das Scheitern der großen Theorie, Frankfurt a.M. 1992; Arturo Escobar, Encountering Development. The Making and Unmaking of the Third World, Princeton, NewYork 1995; Robert Vitalis, The End of Third Worldism in Egyptian Studies, in: Arab Studies Journal 4 (1996), H. 1, S. 13-33; Serge Cordellier/Fabienne Doutaut (Hrsg.), La fin du Tiers monde?, Paris 1996; B. R. Tomlinson, What was the Third World?, in: Journal of Contemporary History 38 (2003), S. 307-321.
- ↑ Vgl. Le Monde, 14.2.1989: Alfred Sauvy im Rahmen einer Buchbesprechung.
- ↑ Vgl. Dieter Schröder, Die Konferenzen der „Dritten Welt“. Solidarität und Kommunikation zwischen nachkolonialen Staaten, Hamburg 1968; Peter Worsley, The Third World, Chicago 1964; J. W. Burton, International Relations. A General Theory, London 1965; Nohlen/Nuscheler (Hrsg.), Handbuch.
- ↑ Vgl. Escobar, Development. Für weitere Literaturhinweise siehe Kalter, Entdeckung, S. 17f.
- ↑ Vgl. Menzel, Ende; Harris, End.
- ↑ Vgl. Greiner, Kalter Krieg; Westad, Global Cold War; Prashad, Nations; Odd Arne Westad, The Project, in: London Review of Books 30 (2008), H. 2, S. 30-31; Odd Arne Westad, Epilogue: The Cold War and the Third World, in: Robert J. McMahon (Hrsg.), The Cold War in the Third World, Oxford 2013, S. 208-219.
- ↑ Vgl. Kalter, Entdeckung; Slobodian, Front.
- ↑ Vgl. Giuliano Garavini, After Empires. European Integration, Decolonization, and the Challenge from the Global South 1957-1985, Oxford 2012; Dinkel, Bündnisfreiheit; Enrico Böhm, Die Sicherheit des Westens. Entstehung und Funktion der G7-Gipfel (1975-1981), München 2014; Akira Iriye, Global Community. The Role of International Organizations in the Making of the Contemporary World, Berkeley 2002.
- ↑ Vgl. Rheinisches JournalistInnenbüro, „Unsere Opfer zählen nicht”. Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg, Berlin/Hamburg 2005.
- ↑ Vgl. Patrick Wagner, Probleme lokaler Staatlichkeit in der nachkolonialen Welt – eine Vergleichsoption?, Vortrag auf dem Historikertag 2010 in Berlin.
- ↑ Vgl. Garavini, Empires; Dinkel, Bündnisfreiheit.
- ↑ Vgl. Vijay Prashad, The Poorer Nations. A Possible History of the Global South, London 2012; Dinkel, Dekolonisierung.
- ↑ Vgl. Kalter, Entdeckung; Slobodian, Front; Speich Chassé, Erfindung.
- ↑ Vgl. Hilger Sowjetunion; Boden, Grenzen. Małgorzata Mazurek, Reconfiguring Backwardness: Polish Social Scientists and the Making of the Third World (in Vorbereitung).
- ↑ Vgl. Nikolas Glover, The Politics of Swedish Economic Relations with the NAM Countries of the Third World, ca. 1955-1970, Vortrag auf der Konferenz “The Role of the Neutrals and Non-Aligned in the Global Cold War, 1949-1989”, 13.-15.3.2014 an der University of Lausanne; Kunter/Schilling (Hrsg.), Globalisierung; Tripp, Weltkirche.
↑ Vgl. Kuchenbuch, Welt; Kuhn, Solidarität.
Copyright © 2014 - Lizenz:
Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V. und Autor:in, alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk ist zum Download und zur Vervielfältigung für nicht-kommerzielle Zwecke freigegeben. Es darf jedoch nur erneut veröffentlicht werden, sofern die Einwilligung der o.g. Rechteinhaber vorliegt. Dies betrifft auch die Übersetzungsrechte. Bitte kontaktieren Sie: redaktion@docupedia.de.